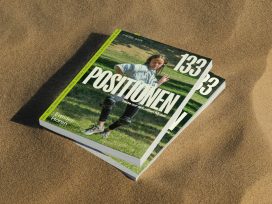
Serious listening
Positionen 4/2022
Featuring an interview with ambient pioneer Suzanne Ciani; the origins and meaning of ‘deep listening’; deconstructing the concert hall; and contemporary opera from Ukraine.
Laudatio anlässlich der Verleihung des Georg-Dehio-Preises 2008 an Richard Wagner.
Meine Damen und Herren,
von einer altertümlichen sumerischen Tontafel aus dem XVIII. Jahrhundert vor Christus konnte man lediglich die Titel, bzw. die Anfangszeilen der Verse ablesen. Dieser Mangel verleitete einen ungarischen Lyriker dazu, die Texte zu einem Gedicht zusammenzufügen. So kann ich dem Versuch nicht widerstehen, aus Richard Wagners Buchtiteln eine Art Wegbeschreibung zu rekonstruieren. Um Klartext zu reden, begann die literarische Laufbahn unseres Autors in einer Zeit der Invasion der Uhren, und, milde gesagt, nicht nur der Uhren. Schriftsteller in seinem Geburtsland zu werden und dazu Verbündete zu finden, bedeutete, sich selbst ab ovo auf eine Abschussliste zu setzen, und dies war immer noch nur Der Anfang einer Geschichte. Träumte jemand damals vom Hotel California, ohne ein gültiges Reisedokument zu besitzen, erlebte er bald Den Tag, der mit einer Wunde begann. Im immer stärker die Sicht verderbenden Gegenlicht versuchte man zunächst Das Auge des Feuilletons offen zu halten, wohl wissend, dass diese Kunstgattung bestenfalls eine Reminiszenz an selige Zeiten der Pressefreiheit sein konnte. Den Machthabenden von damals erschien nicht einmal eine Wettervorhersage harmlos, und so war es kein Wunder, dass der Bericht über den Rostregen die Öffentlichkeit bereits ein paar Länder westwärts erreichen konnte. Inzwischen stellte unser Autor einen Ausreiseantrag, und zwar überhaupt nicht, damit er das Begrüßungsgeld erhält, sondern gewissermaßen als Akt einer Familienzusammenführung zwischen ihm und seinen zukünftigen Lesern, die seine Texte – welch ein Glücksfall! – scheinbar ohne Sprachschwierigkeiten entziffern konnten.
Was hiernach geschah, können wir eindeutig als Entzweiung des Lebenspfades meines langjährigen Freundes und Kollegen Richard Wagner bezeichnen. Einerseits lernte er als frisch gebackener Bundesbürger mit dem hübschen Adler auf dem Reisepass nicht nur die Muren von Wien kennen, ihm wurde sogar Der Himmel von New York im Museum von Amsterdam anvertraut. Andererseits verlor er für keinen Augenblick das intensive, um nicht zu sagen, aufgeregte Interesse für den verlassenen Ort der ersten fünfunddreißig Jahre seines Lebens. Dort passierte soeben etwas, was man niemals für möglich gehalten hätte: Der Sturz des Tyrannen, und damit begann der holprige, etwas suspekte Sonderweg Rumänien. Jenseits der scheinbar hinter sich gebrachten Landschaft blieben mangels des alltäglichen Kommunismus die Völker ohne Signale, über sie breitete sich Der leere Himmel der als Gegenwart spukenden eigenen Historie aus. Hingegen erwiesen sich die Themen der nicht ganz freiwillig angeeigneten Wahlheimat eher als irritierend. Der deutsche Horizont schien Wagner eher Wutanfälle, à la Es reicht! zu entlocken, wobei die Stoßrichtung seiner literarischen Aggression gegen “political correctness” und neuerdings die 68er gerichtet war.
Da ich mich aufgrund der Ungnade der frühen Geburt – eigentlich Frühgeburt – leider zur letzteren Kategorie rechnen muss, fühle ich mich von seiner Kritik häufig persönlich betroffen. Genauer gesagt lese ich diese Texte ambivalent: Einerseits klingen manche seiner Bewertungen aufgrund meiner konservativ-linken, eher emotionalen als ideologischen Reflexe befremdlich, andererseits imponiert mir die souveräne schlechte Laune, mit der er auf selbstverständlich erscheinende Klischees der hiesigen Öffentlichkeit reagiert. Eben die im westlichen Diskurs immer zu wenig akzeptierte Erfahrungswelt des ehemaligen Ostblocks – unser kaum gefragter geistiger Exportartikel – rechtfertigt selbst übertriebene und provokante Reaktionen. Möglicherweise hinterließ bei unserer Generation die fast körperlich erlebte Spaltung der Welt zu bleibende Spuren, um sich in ungestörten Einheitsträumen wiegen zu lassen.
Richard Wagner lernte ich im Frühjahr 1985 in Westberlin kennen, also in der Stadt, die György Ligeti mit einem surrealistischen Käfig verglich, in welchem nämlich die dort Eingesperrten frei sind, während die außerhalb Lebenden unter Unfreiheit leiden. Wir saßen im Garten des Café Einstein und schimpften selbstvergessen glücklich auf das DDR-Regime, wohlgemerkt, unter dem sicheren Schutz der von ihm selbst gebauten Mauer. Dann streiften wir ein bisschen die Sowjetunion, in der binnen kurzer Zeit drei Generalsekretäre an Altersschwäche gestorben waren – ungewöhnlicher Verschleiß! – und landeten irgendwann bei Rumänien, ganz besonders beim Genie der Karpaten, das sich soeben dem Zenith seiner Macht näherte. Ich genierte mich ein wenig, über meinen Parteichef weniger grausame Anekdoten erzählen zu können, und doch glaubte ich in dem mir gegenüber sitzenden jungen Mann einen Gesprächspartner erkannt zu haben, mit dem ich noch sehr lange Gedanken austauschen könnte, denn die gemeinsamen Themen schienen angesichts der realen Lage in unseren real existierenden Ländern schier unerschöpflich zu sein. Das Merkwürdige dabei war, dass ich darauf schwören konnte, er sei ein begabter Autor, obwohl ich in diesem Augenblick noch keine einzige literarische Zeile von ihm gelesen hatte.
Während in der Politik Meinungen aufeinander prallen können, haben in der Belletristik vor allem diejenigen Autoren Recht, die spannende und wahrhaftig gültige Texte schreiben können – und dies lässt sich über Richard Wagner mit gutem Gewissen und einer Dosis Bewunderung für seinen schier unerschöpflichen Stoffreichtum behaupten. Das Eigenartige seines Erzähltalents besteht in jener außergewöhnlichen Glaubwürdigkeit, welche seine Figuren und Situationen auszeichnet. In den Romanen, die aufgrund ihrer Handlungskonstellation auch als Zyklus aufgefasst werden können, wird die konkrete Authentizität der Handlung durch eine einfache Technik erreicht: Der Ingenieur Benda, der Flaneur, André, der Schriftsteller Klaus Richartz und schließlich der Unternehmer Werner Zillich kommen alle aus Rumänien und sind Banater Schwaben, die sich in den achtziger Jahren in der Bundesrepublik niedergelassen hatten. Diese ständige Präsenz von vermutlichen Alter Egos lösten bei Lesungen von Wagner immer wieder die neugierige Frage des Publikums aus, inwieweit es sich bei den Romanen Die Muren von Wien, In der Hand der Frauen, Im Grunde sind wir alle Sieger, Miss Bukarest und schließlich bei der Krönung des Zyklus, den Habseligkeiten um eine mehr oder weniger literarisierte Autobiographie handelt. Diese Frage wird gewöhnlich bei Lisas geheimes Buch – Geständnissen einer Berliner Prostituierten – oder bei dem letzten Werk, Das reiche Mädchen, in dem eine junge deutsche Frau von ihrem serbischen Liebhaber umgebracht wird, seltener gestellt. Dabei findet sich selbst in diesen Büchern je ein Ich-Erzähler, dessen Stimme gespenstische Ähnlichkeiten mit derjenigen der früher genannten Romangestalten aufweist.
Bei allem Respekt gegenüber der voyeuristischen Neugier der Leserschaft und ihrer Vorliebe zu identifizierbaren Haupt- und Nebenfiguren muss ausdrücklich betont werden, dass Richard Wagners verkrachte Existenzen aus allen Ecken des ehemaligen Ostblocks strömen, um die Prachtstraßen des goldenen Westens zu überschwemmen. Sie tragen das Gepäck ihrer Geschichte, die Last der Unterdrückung, die Silhouette des toten Tyrannen im Hinterkopf, persönliche Debatten in engen Kneipen der sechziger bis achtziger Jahre, deren Gegenstand sich heute kaum mehr jemand in Erinnerung rufen kann; sie bringen alte Eifersüchteleien und Spitzelverdächtigungen mit und kultivieren in ihren Alpträumen Urängste um Freiheit, fallweise um Leib und Leben. Mit alldem landen sie in einer Gesellschaft, die sie ohne Wenn und Aber aufgenommen hat, die ihnen jedoch mit ihrem natürlichen und egozentrischen Freiheitskult niemals ganz vertraut geworden ist. Was ist Multikulturalität, wenn nicht das? Und wo, wenn nicht in der Beziehung zwischen Mann und Frau, sollte diese Zeitbombe unterschiedlicher Sozialisierung detonieren?
Das eigentliche Drama von Wagners Helden besteht darin, dass sie, während ihnen die ihnen eigen gewordene Welt fremd geblieben ist, keinen Weg in die alte Heimat zurückfinden. Das heißt, es ist leichter aus der vergangenen Heimat wegzugehen als davon wegzukommen. Am reifsten und besonders erschütternd wird dieser Zustand in der hervorragenden Familiensaga Habseligkeiten geschildert, die vom Schicksal des Banater Schwabentums handelt. Als Werner Zillich zur Beerdigung des Vaters in sein Geburtsdorf reist, lässt er die Geschichte seiner Familie Revue passieren. Urgroßvater Johann, der am Anfang des 20. Jahrhunderts in den USA sein Glück versucht hat, kehrt erfolglos in die Heimat zurück und geht im Ersten Weltkrieg an die Front. Karl, der Vater des Erzählers, gerät nach dem Zweiten in russische Gefangenschaft. Neue Staaten und Grenzen entstehen, das Banat fällt zu großen Teilen an Rumänien. Von seiner Kultur und Tradition bleiben nur noch einige Habseligkeiten: baufällige Häuser, vergilbte Fotos, Ansichtskarten und Gräber. Über mehrere Generationen hinweg verfolgt Wagner die Spuren einer Sippe, die seiner eigenen ähnelt. Er tut es mit bewundernswertem Detailreichtum, ohne Wehleidigkeit, eher sarkastisch, wie einer, der weiß, dass in dieser Gegend der Weltuntergang immer schon im Alltag herumspukte.
Hier jedenfalls können wir über eine maximale Nähe des Helden Zillich zu seinem Verfasser sprechen. Das, was der Romancier hier in ergreifender Akribie schildert, hat der Essayist Wagner vor ein paar Jahren in seinem Balkanbuch zwischen lauten ironischen, mitunter frechen Passagen dargelegt. In diesem Text stoßen wir plötzlich auf ein durchaus persönliches Bekenntnis zur eigenen stillen Trauer:
Das Haus meiner Eltern am Dorfrand ist verkauft. Wir haben es 1997 nach dem Tod meines Vaters verkauft. Meine Mutter und ich. Meine Mutter ist 20 Kilometer weiter gezogen, in eine kleine Wohnung im Zentrum der Kleinstadt. Um die Ecke ist das Bartók-Denkmal. Wenn ich meine Mutter besuche, gehe ich daran vorbei.
Ich sitze in der Fußgängerzone im Café und lese die rumänischen Zeitungen, in denen sich alle gegenseitig der Korruption bezichtigen. Ich lese die Zeitungen, und um mich herum sind die Stimmen der Leute. Ich höre Rumänisch und Ungarisch und Serbisch und manchmal sogar Deutsch.
Ins Dorf fahre ich nicht mehr. Wir fahren nur noch auf den Friedhof. Dort haben wir vier Gräber. Wir besitzen vier Gräber. Das Grab meiner Urgroßeltern mütterlicherseits, das Grab meiner Großeltern und das Grab der Großeltern meines Vaters. Und das Grab, in dem mein Vater liegt. Dieses Grab haben wir geschenkt bekommen. Meine Mutter bekam es von einer Cousine geschenkt, als diese auswanderte vor vielen Jahren.
Ich weiß nicht, was ich mit diesen Gräbern eines Tages anfangen werde.
Hätte die ostmitteleuropäische Literatur so etwas wie einen Schutzheiligen, würde ich diesen dringend darum bitten, meinem Freund Richard Wagner als erstes die Sorgen um die oben erwähnten Gräber abzunehmen und vollständig der lokalen Selbstverwaltung unter strengster Kontrolle aufzubürden. Des Weiteren würde ich den Heiligen auch darum ersuchen, dem Autor besonders viel Gesundheit, Kraft und Lust zur Verfügung zu stellen, damit er ungeachtet jeglicher Markt-, Verlags- und sonstigen Verwicklungen, zur Freude seiner Leser, unter ihnen auch die seltene Sorte lesender Kollegen, am weiteren Aufbau seines Oeuvres arbeiten kann.
Laudatio anlässlich der Verleihung des Georg-Dehio-Preises 2008 an Richard Wagner.
Published 8 January 2009
Original in German
First published by Magyar Lettre Internationale 71 (2008) (Hungarian version)
Contributed by Magyar Lettre Internationale © György Dalos / Magyar Lettre Internationale / Eurozine
PDF/PRINTSubscribe to know what’s worth thinking about.
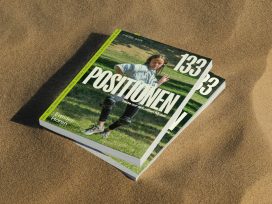
Featuring an interview with ambient pioneer Suzanne Ciani; the origins and meaning of ‘deep listening’; deconstructing the concert hall; and contemporary opera from Ukraine.

The many names of Chernivtsi in Ukraine attest to the tumultuous military and political history of Europe, borne out in cultural and linguistic competition, conflict and compromise in literature, music and art. What traces of this past can still be seen in the city today?