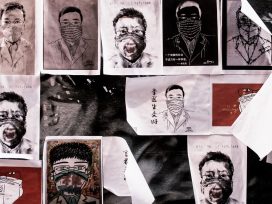Der Kampf gegen “Überfremdung” erscheint immer wieder in der Schweiz, schreibt Rolf Büchi. Es geht in diesem Kampf nicht um eine zu vrteidigende Kultur, sondern um Macht und Herrschaftsordungen. Diese Atmosphäre erschwert auch die soziale Integration allgemein, und der Autor sieht einen Zusammenhang zwischen der “Ausländerfrage” und der Beziehung zwischen der Schweiz und der Welt oder Europa. Nicht nur die rechtspopulistischen Parteien spielen hier ihre Rolle: auch das Bürgertum hängt an der Angst vor dem “Fremden”.
Eine Schnapsidee: In der Schweiz soll der ausländische Anteil an der Wohnbevölkerung maximal 18 Prozent betragen. Eine alte Idee, wiedergeboren 1993 am Stammtisch im Restaurant “Bären” in Reinach, 1995 als nationale Volksinitiative “für eine Regelung der Zuwanderung” in Bern eingereicht, am 24. September 2000 von den Stimmbürgerninnen (64% Nein) und allen Kantonen klar abgelehnt.
Der Vater dieser Schnapsidee heisst Philipp Müller, ein “Mann der Tat”, wie er sich selber beschreibt, ein “Experte” der Migrationspolitik, verheiratet mit Esther, drei Kinder, Bauunternehmer, Ortsparteipäsident der Freisinnig-Demokratischen Partei Reinach, Mitglied des Aargauischen Grossen Rats, Hobbys: Tennis, Politik und Familie, Hundefreund. Ein “gesunder Patriot”, der für die Schweiz einsteht, von der er ein überhöhtes und etwas enges Bild von ihr mit sich herumträgt.
Unterstützt wurde die Initiative von rechtskonservativen Kräften (mehrheitlich aus der Schweizerischen Volkspartei) und von Rechtsradikalen. Bekämpft wurde sie von der Regierung, dem Parlament, der bürgerlichen Mitte (zu der auch die Freisinnig-Demokratische Partei von Philipp Müller gehört), den Sozialdemokraten und Grünen, den Gewerkschaften und Arbeitgeberorganisationen sowie einer grossen Anzahl von Nichtregierungsorganisationen.
Ganz selbstverständlich betrachteten die Befürworter “Ausländer” als eine Belastung für die Schweiz, die oberhalb einer bestimmten Grenze untragbar wird. Völlig willkürlich wählten sie 18 Prozent als oberste Belastungsgrenze, weil 1994, als die Initiative lanciert wurde, gerade 18 Prozent der Schweizer Bevölkerung als “Ausländer” klassifiziert waren.
Die Gegner fürchteten sich vor den negativen Folgen der Initiative; sie meinten, die Wirtschaft und der gute Ruf der Schweiz würden geschädigt, die bilateralen Abkommen mit der EU gefährdet und Grundwerte der Verfassung verletzt.
Zwar sind auch viele von den Gegnern des Volksbegehrens, von links bis rechts, für eine Kontrolle und Begrenzung der Einwanderung. Aber sie argumentieren, dieses Ziel lasse sich viel flexibler mit einem neuen Ausländergesetz erreichen. Der Entwurf zu einem solchen Gesetz wird gegenwärtig in den politischen Mühlen gemahlen. Noch weiss niemand, was dabei herauskommen wird. Soviel kann man aber mit grosser Sicherheit schon jetzt sagen: Für Staatsangehörige aus EU/EFTA-Staaten werden die Freizügigkeitsregeln der Europäischen Union gelten; das neue Ausländergesetz wird also nur Angehörige aus anderen Staaten betreffen; aus diesen Ländern sollen nur “dringend benötigte qualifizierte Arbeitskräfte” und ihre Familien zugelassen werden.
Der Teil der Einwanderung, der sich noch regulieren lässt, soll also nicht durch eine fixe Quote, sondern durch eine möglichst flexible Politik, die sich an wirtschaftlichen und nationalen Nützlichkeitskriterien orientiert, geregelt werden. Diese Politik ist nicht sehr originell; sie ist weniger typisch für die Schweiz als vielmehr typisch nationalstaatlich. Sie begrenzt die Anwendung humanitärer Prinzipien auf die Bereiche, in denen diese Prinzipien bestimmten wirtschaftlichen und nationalen Nützlichkeitskriterien nicht im Wege stehen.
Der lange Kampf gegen die “Überfremdung”
Während des Abstimmungskampfes hatte ich sehr oft den Eindruck, dass die Dinge nicht beim Namen genannt werden. Die Forderungen von Müller und seinen Gesinnungsfreunden sind ja Ausdruck einer langen Tradition schweizerischer Fremdenfeindlichkeit, dem Kampf gegen die “Überfremdung”. Verständlicherweise liegt der offiziellen Schweiz wenig daran, diesen Aspekt des schweizerischen Nationalismus ins öffentliche Bewusstsein zu heben.
Das Wort Überfremdung lässt sich nur schwer in andere Sprachen übersetzen. Es soll ein Bild der Schweiz hervorrufen, das Angst macht, nämlich die Vorstellung, dass die Zahl oder der Einfluss der “Ausländer” zu gross geworden ist, so dass die “Schweizer” ihre besondere nationale Identität und ihre eigenständigen Traditionen verlieren. “Überfremdung” ist die Vorstellung von der Verdrängung der “schweizerischen” durch “fremde” Kultur. Im finnischen Kontext entspricht die Angst vor der “Russifizierung” einer Form von “Überfremdungs”angst.
Die 18 Prozent-Initiative war das sechste Volksbegehren gegen die “Überfremdung” seit 1970. Wohl ist bisher keine dieser Initiativen von den Stimmbürgern angenommen worden. Aber das heisst nicht, dass diese Initiativen ohne politische Folgen geblieben sind – im Gegenteil: auch abgelehnte Volksbegehren haben meistens Folgen.
So bewirkte die knappe Verwerfung der ersten Überfremdungsinitiative (1970; 54% Nein) einen Kurswechsel in der Ausländerpolitik. Seither verfolgt der Bundesrat, ganz im Sinne der Überfremdungsbewegung, eine Politik der Regulierung der gesamten ausländischen Wohnbevölkerung (nicht mehr nur des Arbeitsmarktes) zwecks Schutz der schweizerischen Kultur. Diese Politik der Stabilisierung und Reduktion der ausländischen Wohnbevölkerung hat ihr Ziel natürlich immer wieder verfehlt und die Zahl der Ausländer ist in den letzten Jahren wieder stark gewachsen. Dies veranlasste Philipp Müller dazu, seine 18-Prozent-Initiative zu starten.
Die Idee der “Überfremdung” entstand im Kontext einer europaweiten Rechtswende des Nationalismus. In der Schweiz führte diese Entwicklung zu einer Art Ethnisierung des nationalen Wir-Bildes: auf Kosten der liberalen Staatsbürgernation bekam die schweizerische Kulturnation, d.h. die Vorstellung eines natürlich gewachsenen besonderen “Schweizertums” immer mehr Kraft. Es entstand eine Spannung zwischen dem politischen und dem kulturellen Selbstverständnis; der Begriff der natürlich gewachsenen Nation erfüllt die demokratischen Normen nicht, die mit dem Begriff der Staatsbürgernation verbunden sind.
Dieser Wandel des nationalen Gemeinschaftsdenkens veränderte das Koordinatensystem, an dem sich erfolgreiche Politik, ob von links oder rechts, orientieren musste. Wer ihn berücksichtigt, gewinnt ein besseres Verständnis für die Schweizer Politik. Fremdenfeindlichkeit in der Gestalt eines Kampfes gegen die “Überfremdung” wurde als Folge dieses Wandels zu einem konstitutiven Element des schweizerischen Nationalismus im 20. Jahrhundert. Sie hat bis in die 1990er Jahre eine hohe soziale Bindungskraft ausgeübt.
Der offizielle Kampf gegen die “Überfremdung” begann im Ersten Weltkrieg. Der Bundesrat schuf eine besondere Behörde zum Schutz des Schweizertums und des Schweizer Arbeitsmarktes: die eidgenössische Fremdenpolizei. Mit der Zeit erweiterte sich das Überfremdungsdenken im Staat und in der Gesellschaft zum nationalen Konsens: alle etablierten Parteien und Gruppen unterstützten fortan eine fremdenfeindliche und nationalistische Ausländerpolitik. Immer wieder fürchteten sie den Umsturz ihrer Gesellschaftsordnung und fühlten sich aufgerufen, die schweizerische Kultur und Identität gegen “Fremde” zu verteidigen: Um 1918 befürchteten die bürgerlichen Parteien einen sozialistischen Umsturz, in den 1930/40er Jahren vereinte die Furcht vor dem Nationalsozialismus bürgerliche Parteien und Sozialdemokraten, in den 1960/70er Jahren wehrte das Establishment sich gegen den Einfluss der Fremdarbeiter und danach traten Einwanderer und Flüchtlinge aus “fremden” Kulturen in den Mittelpunkt des “Überfremdungs”-Diskurses.
Macht nicht Kultur verteidigen
Die Praxis des Kampfes gegen “Fremde” und “fremde” Einflüsse ist die Umkehrung seiner Theorie. Sie zeigt, worum es wirklich geht, nämlich nicht um Kultur, sondern um Macht. Im “Fremden” bekämpft jede Partei den Feind jener Herrschaftsordnung, die sie verteidigen oder anstreben. Der “Fremde” steht für die Bedrohung einer sozialen Ordnung, so wie sie ist oder sein sollte. In der Theorie verteidigt man sich gegen einen Prozess der Entschweizerung, genannt “Überfremdung”, und appelliert an die Schweizer, nationale Identität und Kultur gegen ihre angeblichen Feinde zu verteidigen. Dieser Theorie entspricht eine Herrschaftspraxis, die genau das Umgekehrte tut, nämlich eine Politik der Verschweizerung betreibt, die ihre Zwänge auf alle Bewohner des Landes ausübt. Diese Politik zielt auf die Zerstörung “fremder” Identität und Kultur und deren Ersetzung durch eine “schweizerische”; wer sich nicht an das von den Mächtigen definierte Schweizertum assimilieren will oder kann, wird ausgegrenzt.
Vor 1914 und solange man sich noch an der liberalen Staatsbürgernation orientierte, wurde Einbürgerung als Mittel zur Integration der Ausländer betrachtet. Es gab Pläne für eine erleichterte Einbürgerung, die kurz vor ihrer Verwirklichung standen. Dann kam der erste Weltkrieg und mit ihm ein jäher Gesinnungswandel in der Einwanderungs- und Einbürgerungspolitik. Der lange Kampf gegen die “Überfremdung” hatte begonnen und man orientierte sich mehrheitlich an der Vorstellung einer schweizerischen Kulturnation. Bei der Herstellung dieser Kulturnation ist Assimilation ein Schlüsselprozess, mit dem die Herrschenden ihre Bevölkerung homogenisieren, d.h. monokulturalisieren. In dieser Herrschaftsperspektive konnte ein “Fremder” durch Einbürgerung nicht mehr zum Schweizer gemacht werden, vielmehr musste er sich in einem langen Prozess der Assimilation erst zu einem solchen entwickeln. Hiess es vor 1914 “Ohne Einbürgerung keine Assimilation”, so hat es seither geheissen: “Ohne Assimilation keine Einbürgerung”. Dieser Wandel zeigt, wie sehr Vorstellungen von einem natürlich gewachsenen Schweizertum an symbolischer Macht gewonnen hatten und Politik und Einstellungen im 20. Jahrhundert zu prägen vermochten.
Die Überfremdungsgefahr wurde immer dann akut, wenn die bürgerliche Herrschaft sich bedroht fühlte. Dann wurde der Kampf gegen die “Fremden” intensiviert, um die Gesellschaft vor dem Chaos und Umsturz zu bewahren. Die Saubermänner von der Fremdenpolizei (zuständig für die Zulassung) und die Schweizermacher (zuständig für die Einbürgerung) sorgten für die Reinerhaltung des Schweizertums; sie trennten die Spreu vom Weizen: hier die Assimilierbaren (staatstreu, nützlich, wertvoll), dort die Nicht-assimilierbaren (staatsgefährdend, schädlich, wertlos).
Die Opfer oder Objekte dieser Reinhaltepolitik wechseln (zuerst waren es Einwanderer aus den Nachbarstaaten, dann die sogenannten Ostjuden, danach Fremdarbeiter, später Tamilen und heute sind es Menschen aus “fremden Kulturen”, d.h. aus Bosnien, Kosovo und der sogenannten Dritten Welt), die Behandlung und deren Begründungen bleiben sich gleich.
Ein Standardargument macht die Opfer der Fremdenfeindlichkeit zu deren Ursache. Im Zweiten Weltkrieg versperrte man jüdischen Flüchtlingen den Zugang zur Schweiz, um hier Antisemitismus zu verhindern. Oder es wird behauptet, dass stärkere Einwanderung oder die Anwesenheit unerwünschter Ausländer Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus hervorrufen oder stärken würden. Beispielsweise Christoph Blocher und seine nationalkonservativen Gefolgsleute verwenden dieses Argument. Auf diese Weise wird der Kampf gegen die “Fremden” legitimiert als Abwehr von Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus.
Von der “Überfremdung” zur “Integration”
Auch in der Schweiz gibt es gegenwärtig Diskussionen über und Demonstrationen gegen rechtsextreme Gewalt. Der von Blocher dirigierten Mehrheit der Schweizerischen Volkspartei wird vorgeworfen, sie sei mit ihrer fremdenfeindlichen Politik Wegbereiter für den Rechtsextremismus. Blocher wehrt sich gegen solche Vorwürfe mit dem Argument, dass das Artikulieren von heissen Themen Extremismus verhindert, das Unterdrücken der Diskussion und die Untätigkeit der Regierenden ihn hingegen fördern.
SVP und nationalkonservative Bewegung führen den Kampf gegen die “Überfremdung” fort. Blocher bekennt sich offen dazu. Er wehrte sich nicht gegen die Formulierung, dass er Haltungen wie “Die Schweiz den Schweizern” (sic!) vertrete. Auf die Frage, ob eine solche Einstellung nicht den Fremdenhass fördere, antwortete er: “Nein. Denn jedes Land dieser Welt hat das Recht, seine historische, kulturelle und gesellschaftliche Eigenart vor einem unkontrollierten Zustrom von Fremden zu bewahren, die allein durch ihre Masse die Identität dieses Landes gefährden würden. Den Fremdenhass fördern jene, welche die Augen vor den Problemen einer unbegrenzten Immigration verschliessen.”
Zwar ist Fremdenfeindlichkeit ein Ingredienz der nationalkonservativen SVP-Politik, die sich für die Wiederherstellung einer heilen Welt für Schweizer und assimilierte Ausländer stark macht. Aber, wenn man mit dem Finger nur auf die SVP und auf die Rechtsextremisten am Rande der Gesellschaft zeigt, dann verdrängt man das Wesentliche: die viel weitere Verbreitung der Fremdenfeindlichkeit und die Quellen, aus denen sie erzeugt und ernährt wird. Diese Verdrängung hat zudem den Vorteil, die etablierte Politik von ihrer Verantwortung zu entlasten.
In der Schweiz ist offiziell vom Ersten Weltkrieg bis zum Ende des Kalten Krieges ein Kampf gegen die “Fremden” und “fremde” Einflüsse geführt worden. Regierung, Parlament und Parteien, genauso wie viele Bürgerinnen und Bürger haben diesen Kampf gegen die “Überfremdung” verinnerlicht; er ist ein Teil ihres Habitus geworden und ein Teil der politischen Kultur. Diese nationalistische Politik erzeugt eine alltägliche Fremdenfeindlichkeit, eine alltägliche und selektive Diskriminierung von Menschen, die verschiedenen Ausländerkategorien zugeordnet werden und diese alltägliche Fremdenfeindlichkeit ist das eigentliche Problem.
Sie erschwert die gesellschaftliche Integration ganz allgemein, weil sie einer sehr grossen Minderheit von niedergelassenen Ausländern die gleiche politische Teilnahme verweigert, d.h. die Schweizer Demokratie unterminiert, indem sie aus dieser eine Privilegiertenordnung macht. Sie erschwert die volle Integration jener “Ausländer”, denen sie allein auf Grund ihrer Herkunft die Einbürgerung verweigert, wie das beispielsweise in der Gemeinde Emmen geschehen ist. Sie erschwert insbesondere auch die Lösung von Konflikten zwischen “Schweizern” und “Nicht-Schweizern” am Arbeitsplatz, am Wohnort, in der Schule etc. und die Bekämpfung von Rechtsextremismus, der durch die alltägliche Fremdenfeindlichkeit gestärkt wird.
Bis 1989 war der Kampf gegen die “Überfremdung” ein Bestandteil des offiziellen schweizerischen Nationalismus, der für alle etablierten Parteien verbindlich war. Nach 1989 begann sich das zu ändern. “Überfremdung” wurde immer mehr zum Kampfmittel einer rechtskonservativen Bewegung unter Führung der Blocherschen SVP. Die “Ausländerfrage” vermischte sich mit der Frage der Beziehungen zwischen der Schweiz und Europa/der Welt: Soll die Schweiz Mitglied der Europäischen Gemeinschaft/UNO werden oder weiterhin ihre Politik der splendid isolation betreiben?
Diese Frage hatte sich schon einmal, in der Anfangszeit der Europäischen Gemeinschaft gestellt. Damals entschloss sich das vereinte Establishment zur Fortsetzung des Alleinganges und verfügte im Kampf gegen die “Überfremdung” über ein geeignetes Instrument zur Durchsetzung dieser Politik.
Heute, unter Bedingungen, die sich seit 1989 bekanntlich grundlegend verändert haben, geht die Entwicklung in die umgekehrte Richtung. Die Regierung erklärte den Beitritt zur UNO und zur EU zu ihrem strategischen Ziel.
Über der Europafrage hat sich das bürgerliche Lager gespalten, in eine bürgerliche Mitte und eine nationalkonservative Rechte. Diese Rechte führt einen konsequenten Kampf gegen die “Überfremdung” und hat damit Erfolg. Es gelang ihr den Beitritt zur UNO (1986) und zum EWR (1992) zu verhindern und die Asylgesetzgebung ständig zu verschärfen. In diesen Kämpfen sind die nationalkonservative Bewegung und die SVP sehr stark geworden.
Der Übergang von der “Überfremdung” zur Integration wird jedoch nicht nur von den Nationalkonservativen, die einen Verteidigungskampf gegen gesellschaftliche Veränderungen führen, behindert. Auch die bürgerliche Mitte hat grosse Mühe, sich vom Kampf gegen die “Fremden” zu lösen, der ihr in Fleisch und Blut gegangen ist. Dementsprechend ist die Politik der Regierung ambivalent; sie fährt in zwei verschiedene Richtungen. Einerseits erklärt sie Integration zum obersten Ziel. Anderseits verfolgt sie weiterhin die Verteidigung des Schweizertums mit repressiven Mitteln. Einerseits wird versucht, Einbürgerung leichter zu machen und deshalb, dies als Beispiel, führte man 1992 die doppelte Staatsbürgerschaft ein. Anderseits gilt bei den bürgerlichen Parteien nach wie vor das Motto: Ohne Assimilation keine Einbürgerung. Ganz im Sinne der Vorstellungen vom besonderen “Schweizertum” halten die bürgerlichen Parteien an der Vormacht der Schweizer Kultur fest und verstehen Integration als Assimilation, d.h. als einseitige Anpassung der “Ausländer” an die “Schweizer”.
Die Sozialdemokratische Partei tritt am entschiedensten für einen Beitritt zur EU ein und hat als erste der grossen Parteien ihre Politik von der “Überfremdung” auf die Integration umorientiert. Sie wird darin von der Grünen Partei unterstützt. Beide wollen die Augen nicht mehr vor der Tatsache verschliessen, dass die Schweiz ein Einwanderungsland und eine “multikulturelle” Gesellschaft ist. Die bürgerliche Mitte ist noch nicht so weit; sie will nicht zu viel von der “multikulturellen” Gesellschaft, die sie als Bedrohung der Schweizer Identität fürchtet. Rechts von der Mitte will man natürlich sowieso nur schweizerische Monokultur und bekämpft die “Fremden”, weil sie nur Probleme und Belastungen mit sich bringen. Pardoxerweise erzeugen die “wahren Patrioten” mit ihrer Ausgrenzungspolitik eine Art von “multikultureller” Gesellschaft aus privilegierter Mehrheit und diskriminierten Minderheiten, die mit genau jenen Problemen behaftet ist, die zu bekämpfen sie vorgeben.
1913 nannte der Staatsrechtler Jakob Burckhardt jene Kategorien von Menschen, die keinen Zutritt zur Schweiz haben sollen: persönlich Defekte, politisch Gefährliche, wirtschaftlich Nutzlose, Fremdrassige (heute heissen sie Fremdkulturelle). Zutritt erhalten also jene, von denen sich die Herrschenden einen Nutzen versprechen. Das gilt auch heute noch und zwar nicht nur in der Schweiz. Kategorien, wie sie von Burckhardt formuliert wurden, sind immer noch relevant, auch wenn man heute anstatt von Fremdrassigen von kultureller Distanz spricht Was geschieht, wenn diese Herrschaftslogik auf alle Menschen angewendet wird, Innländer und Ausländer? Wer oder was garantiert, dass dem nicht eines Tages so sein wird?
Published 14 March 2001
Original in German
First published by Ny Tid
Contributed by Ny Tid © Rolf Büchi / Ny Tid / Eurozine
PDF/PRINTNewsletter
Subscribe to know what’s worth thinking about.