Stellen wir uns vor, wir sind aufgefordert, zwei Fragen zwei beantworten: Lässt sich von einer chinesischen Identität reden, die sich im Laufe der Geschichte herausgebildet hat und die China von der übrigen Welt unterscheidet? Kann diese Identität für die Chinesen zukunftsweisende Bedeutung haben?
Für einen durchschnittlichen Chinesen liegt die Antwort auf beide Fragen so sehr auf der Hand, dass es sich erübrigt, sie zu stellen. Und das gilt zweifellos nicht minder für den durchschnittlichen Europäer, der von außen auf China blickt. Derselbe Europäer trüge indes viel größere Bedenken, wenn er die gleichen Fragen im Blick auf Europa beantworten müsste. Woher kommt dieser Unterschied zwischen einem Chinesen und einem Europäer? Die Antwort lässt sich leicht geben. Ein Chinese ist gewohnt, China als einheitliches kulturelles und politisches Gebilde zu betrachten – als ein Reich. Die Europäer hingegen sind gewohnt, in Begriffen der Verschiedenartigkeit zu denken – einer Vielfalt von Sprachen, Kulturregionen, Religionen und religionsinternen Konfessionen und natürlich und vor allem einer Vielzahl von Nationen.
Letzteres hat das europäische Denken und die europäische Imagination so lange und so machtvoll geprägt, dass Europa als eine Realität, die sich von einem Konglomerat aus Nationen unterscheidet und sich nicht darin erschöpft, für Europäer ein Problem darstellt und dass die Europäer sich selbst als Europäer problematisch sind. Holländer oder Pole zu sein scheint etwas Selbstverständliches: Den Bezugspunkt bilden hier eine gemeinsame Sprache, eine bestimmte Erziehung, Traditionen, Vorurteile, Gewohnheiten, Bräuche und ähnliches mehr. Ein Europäer zu sein ist hingegen alles andere als selbstverständlich. Deshalb ist es unmöglich, die Frage nach einer “europäischen Identität” zu beantworten, ohne zuvor zu zeigen, dass sich sinnvoll von einem Europa sprechen lässt, welches sich nicht darin erschöpft, ein Kontinent oder ein politischer Verbund zu sein, sondern das darüber hinaus ein den einzelnen Nationen komplementäres und sie überlagerndes kulturelles und historisches Gebilde eigener Art darstellt.
I
Am leichtesten ist dieser Nachweis durch einen Vergleich Europas mit seinen Nachbarn zu führen. Die Gegenüberstellung, die auf eine Betrachtung Europas aus der Außenperspektive hinausläuft, fördert mehrere Eigentümlichkeiten zutage, durch die sich der europäische Siedlungsraum von den muslimischen Gebieten Nordafrikas und des Vorderen Orients wie auch von China unterscheidet, wenn wir denn bereit sind, den Raum bis zu den östlichen Grenzen Russlands als Europa gelten zu lassen. Beginnen wir mit den Eigentümlichkeiten, die mit bloßen Sinnen zu erfassen sind. Das auffälligste Merkmal dürften wohl die Kreuze sein, die sich auf manchen Gebäuden, auf Friedhöfen, nicht selten auch an Wegkreuzungen und Wegrändern finden. Das zweite dürften die Anlagen und die Architektur der städtischen Siedlungen sein, zumal was die öffentlichen Gebäude betrifft. Sehen wir von dem weltweiten Stil ab, der seit den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts en vogue ist, dann scheint der am weitesten verbreitete Baustil jener zu sein, den wir als “klassizistisch” bezeichnen. Das dritte ist die alphabetische Schrift, die sich sowohl von der chinesischen Bilderschrift als auch vom arabischen Alphabet und anderen Buchstabenschriften unterscheidet; von dieser Schrift existieren drei Hauptformen, die aber unverkennbar derselben Familie angehören. Das vierte Merkmal sind die zahlreichen Bildnisse, von denen der öffentliche Raum ebenso wie die Wohnstätten normaler Bürger bevölkert sind. Das fünfte ist die Häufigkeit, mit der diese Bildnisse Menschen beiderlei Geschlechts darstellen, und zwar nicht selten nackt. Das sechste ist das Glockengeläut. Das siebente Merkmal ist die überall anzutreffende griechische, römische und/oder mittelalterliche Hinterlassenschaft, in Form von Bauwerken oder Ruinen und von Objekten, die in Museen aufbewahrt werden. Einige dieser Merkmale sind europaspezifisch. Andere finden sich auch andernorts. Aber zusammengenommen bilden sie ein einzigartiges visuelles und akustisches Szenarium, das sich außerhalb von Europa nur in Gegenden findet, die von Europäern bewohnt werden.
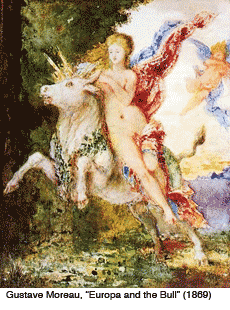 Meine Aufzählung ist zweifellos unvollständig. Und sie ist sehr allgemein gehalten, um alle Kulturregionen Europas einzuschließen, insbesondere die des Westens und des Ostens, die sich in der Gestalt ihrer Kirchen unterscheiden (die im Osten zwiebelförmige Kuppeln tragen), im Aussehen ihrer Priester, in den verwendeten Alphabeten, in der landeseigenen Architektur, in der Häufigkeit der Darstellung nackter Körper, die im Osten viel geringer ist. Darüber hinaus konzentriert sich die Aufzählung auf diejenigen Merkmale, die im europäischen Raum vorherrschen und fast überall ins Auge fallen und vorhanden sind; deshalb wird bewusst abgesehen von der zwei Jahrtausende alten Präsenz der jüdischen Minderheit in Europa und dem Globalisierungsprozess der letzten vier Jahrzehnte, in dessen Konsequenz sich beträchtliche muslimische, chinesische, hinduistische und der Sikhreligion angehörige Bevölkerungsgruppen in Europa niedergelassen haben. Und die Aufzählung beansprucht auch nur im Sinne eines statistischen Mittelwerts Geltung: An manchen Orten finden sich die auszeichnenden Charakteristika des europäischen Kulturraums in konzentrierter Form und deutlich sichtbar, während sie an anderen Stellen dünn gesät und nur schwach vorhanden sind. Würde man versuchen, die Verbreitung jener Merkmale kartographisch zu erfassen, so würde sich mit Sicherheit zeigen, dass ihre Dichte in einigen Teilen Westeuropas am größten ist.
Meine Aufzählung ist zweifellos unvollständig. Und sie ist sehr allgemein gehalten, um alle Kulturregionen Europas einzuschließen, insbesondere die des Westens und des Ostens, die sich in der Gestalt ihrer Kirchen unterscheiden (die im Osten zwiebelförmige Kuppeln tragen), im Aussehen ihrer Priester, in den verwendeten Alphabeten, in der landeseigenen Architektur, in der Häufigkeit der Darstellung nackter Körper, die im Osten viel geringer ist. Darüber hinaus konzentriert sich die Aufzählung auf diejenigen Merkmale, die im europäischen Raum vorherrschen und fast überall ins Auge fallen und vorhanden sind; deshalb wird bewusst abgesehen von der zwei Jahrtausende alten Präsenz der jüdischen Minderheit in Europa und dem Globalisierungsprozess der letzten vier Jahrzehnte, in dessen Konsequenz sich beträchtliche muslimische, chinesische, hinduistische und der Sikhreligion angehörige Bevölkerungsgruppen in Europa niedergelassen haben. Und die Aufzählung beansprucht auch nur im Sinne eines statistischen Mittelwerts Geltung: An manchen Orten finden sich die auszeichnenden Charakteristika des europäischen Kulturraums in konzentrierter Form und deutlich sichtbar, während sie an anderen Stellen dünn gesät und nur schwach vorhanden sind. Würde man versuchen, die Verbreitung jener Merkmale kartographisch zu erfassen, so würde sich mit Sicherheit zeigen, dass ihre Dichte in einigen Teilen Westeuropas am größten ist.
Gehen wir nun von den sinnlich wahrnehmbaren Unterschieden zu den Differenzen über, die sich nur durch einen Vergleich der europäischen Gesellschaft mit den Nachbargesellschaften ermitteln lassen, so entdecken wir folgende Eigentümlichkeiten:
Erstens besitzt Europa eine ganz eigene Zeiteinteilung. Das beginnt mit der Wochenfolge, in der der Sonntag ein offizieller Feiertag ist. Aber es erstreckt sich auch auf das Jahr mit seinen Festen und Feiertagen. Die Feste, insbesondere Weihnachten und Ostern, sind Gemeingut des westlichen und des östlichen Europas, wenn sie auch zu verschiedenen Zeiten gefeiert werden, weil der Anfang des kirchlichen Jahres im Westen und Osten nicht im Datum übereinstimmt. Die Feiertage sind länderspezifisch, wobei es aber in allen Ländern einen Nationalfeiertag oder einen Tag zur Feier des Kriegsendes gibt. Zweitens verfügt Europa über bestimmte kulturelle Bezugspunkte. Wenn man nachforscht, welche Titel, Namen, Ereignisse und Orte in europäischen Schriftzeugnissen, Bildkunstwerken, religiösen und zivilen Zeremonien, politischen Diskursen und so weiter am häufigsten auftauchen, stellt man fest, dass fast alle von ihnen außerhalb Europas entweder unbekannt oder höchstens kleinen gebildeten Minderheiten vertraut sind, abgesehen von jenen, die das Christentum auf allen Kontinenten verbreitet hat. Dabei spielen neben christlichen und jüdischen Traditionen das antike Griechenland und das Römische Reich eine ziemlich große Rolle; der Westen bezieht sich eher auf das Mittelalter römisch-lateinischer Prägung, während der Osten sich stärker an Byzanz orientiert. Die Kunst und Literatur, die Wissenschaften, die politischen Lehren und die Rechtsnormen der Moderne finden sich in allen Teilen Europas. Ohne Frage haben sich manche dieser kulturellen Bezüge mittlerweile über die ganze Welt verbreitet. Aber wenn wir sie statistisch erfassen und das Ergebnis kartographieren könnten, würde sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit herausstellen, dass in Europa die Verbreitung die größte Dichte aufweist.
Die dritte Auffälligkeit Europas ist sein säkularer Charakter, womit ich die Trennung der Politik von der Religion und der Staatsbürgerschaft von der Zugehörigkeit zu einer Religion oder Konfession meine. Die vierte Eigentümlichkeit ist die Stellung der Frauen: Die europäischen Rechtsordnungen kennen nur die monogame Ehe; die Frauen in Europa leben nicht eingesperrt in Frauenhäusern oder Harems, sie sind nicht gezwungen, ihr Gesicht zu verhüllen, und stets haben auch Frauen eine wichtige Rolle in der europäischen Kultur und auch in der Politik Europas gespielt. Das fünfte Element des besonderen Charakters Europas ist das Fehlen von Nahrungstabus, ein weiteres Erbe des Christentums, das sich in diesem Punkte vom Judentum und vom Islam unterscheidet. Schwerer in Kürze darzustellen sind eine Reihe von Gewohnheiten, die Teil des Alltagslebens sind und ihren Niederschlag in der Einrichtung europäischer Wohnungen und Büros finden. Wenngleich in wechselndem Umfang gilt all dies auch für die Länder, die ihre Entstehung der europäischen Expansion vom 16. bis zum 19. Jahrhundert verdanken: für die Vereinigten Staaten, Kanada, die Länder Lateinamerikas, Australien und Neuseeland. Der Einfachheit halber sehe ich hier von den Besonderheiten dieser Länder ab und behandle sie so, als seien sie reine Projektionen Europas in die außereuropäische Welt.
Ich betone noch einmal, dass diese Aufzählung keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Aber was wir angeführt haben, genügt, um die Frage nach der Existenz europaspezifischer Merkmale, die den Kontinent von der übrigen Welt unterscheiden, positiv zu beantworten. Wenn in diesem Punkte Übereinstimmung herrscht, müssen wir nach einer Erklärung dafür suchen, warum es einerseits in Europa eine so augenfällige Vielfalt von Sprachen, Religionen und Konfessionen, Zeichen und Symbolen, Staaten und Nationen gibt, während andererseits eine Einheit vorhanden ist, die zwar weniger ins Auge fällt, dennoch aber durch die Vielzahl von Gemeinsamkeiten bezeugt wird, die die verschiedenen Gruppen von Europäern in unterschiedlichem Grade und Umfang verbindet und die sie allesamt von den muslimischen oder chinesischen Nachbarn abhebt. Wollen wir nutzlose Spekulationen vermeiden und uns auf dem Boden einer durch rationale Methoden gewonnenen Empirie bewegen, dann kann uns die gesuchte Erklärung für die Einheit und zugleich Vielfalt Europas nur die Beschäftigung mit seiner Geschichte liefern.
II
Das heutige Europa mit all seinen Eigentümlichkeiten ist tatsächlich die Frucht einer langen Geschichte. Deren Beginn würde ich um die Mitte des ersten vorchristlichen Jahrtausends ansetzen. Damals fingen die Griechen an, die Küsten des Mittelmeers und des Schwarzen Meers zu besiedeln und traten in engeren Kontakt mit den Kelten, die das Zentrum des Kontinents bevölkerten und, grob gesprochen, entlang der Donau und dem Rhein im Norden und südlich davon im damaligen Gallien und heutigen Frankreich sowie in Norditalien und in Nordspanien siedelten. Die Kontakte führten dazu, dass die Kelten in von den Griechen bewohnte Gebiete vordrangen und ihre Gesellschaften sich allmählich wandelten. Und das wiederum hatte indirekt zur Folge, dass sich die nördlichen und östlichen Nachbarn der Kelten – nennen wir sie Barbaren, ohne damit ein abschätzig wertendes Urteil zu verbinden! – nach Süden ausbreiteten. Der Einfluss, den Großgriechenland im südlichen Italien auf seine Nachbarn ausübte, beförderte außerdem das Wachstum und die Ausbreitung des kleinen, Lateinisch sprechenden Stammes, der im Umkreis von Rom siedelte. Im Laufe der Jahrhunderte unterwarfen die Römer zuerst ihre etruskischen und später ihre griechischen Nachbarn und machten sich dann an die Eroberung des Mittelmeers, Norditaliens und des transalpinen Galliens. Nach fünf weiteren Jahrhunderten der Kriege und Kolonisierungen wich die anfängliche Dreiteilung des Kontinents mit den Barbaren im Norden, den Kelten in der Mitte und den Griechen und Römern im Süden um das erste Jahrhundert nach Christus einer neuen, zweigliedrigen Aufteilung: Den Süden nahm das Römische Reich ein, den Norden bildeten die Gebiete der Barbaren, wobei ersteres von den letzteren durch den Limes, die befestigte Grenze, getrennt war, die sich von der Nordsee mehr oder weniger entlang der Linie des Rheins und der Donau bis zum Schwarzen Meer erstreckte.
Die Unterscheidung zwischen “römisch” und “barbarisch” existiert im westlichen Teil des Kontinents bis zum heutigen Tag in dem Gegenüber von romanischer und germanischer Sprachfamilie, wohingegen die keltischen Sprachen entweder verschwunden oder auf Randgruppen geschrumpft sind. Der Unterschied erwies sich auch in religiöser und kultureller Hinsicht als von wesentlicher Bedeutung: Die Reformation des 16. Jahrhunderts mit ihrer starken Stellung in den vormals barbarischen Regionen schaffte es nie, in den einstigen römischen Regionen Wurzeln zu schlagen, sieht man von ein paar sehr begrenzten Gebieten ab. Ehe wir indes auf diese spätere Entwicklung zu sprechen kommen, müssen wir noch eine weitere sprachliche und kulturelle Trennlinie innerhalb des Römischen Reiches würdigen: die zwischen dem lateinischen Westen und dem griechischen Osten. Lange Zeit hindurch schuf sie keine Probleme. Im vierten Jahrhundert indes kam es in Reaktion auf den Druck der von allen Seiten andrängenden Barbaren zur Einrichtung zweier Militär- und Verwaltungsgebiete, die sich schließlich zu eigenständigen Reichen entwickelten – einem lateinisch-weströmischen Reich mit Rom und einem griechisch-oströmischen Reich mit Konstantinopel als Hauptstadt. Dies vollzog sich in einem ganz neuen religiösen Klima, entstanden durch die Ausbreitung des Christentums, welches seit dem vierten Jahrhundert Staatsreligion im Römischen Reich war. Die beiden politischen Hauptstädte wurden zugleich als Sitz des Papstes beziehungsweise des Patriarchen zu religiösen Hauptstädten, wobei Konstantinopel als Sitz des Kaisers ein viel größeres Gewicht beanspruchte.
Die Trennung zwischen dem lateinischen Westen und dem griechischen Osten vertiefte sich vom fünften Jahrhundert an, weil im Westen, den die Barbaren eroberten und in dessen Territorien sie sich festsetzten, das Reich schließlich erlosch. Die einzige Autorität, die aus der imperialen Vergangenheit überdauerte, war die des Papstes in Rom; sie war anfänglich schwach und beschränkt, aber allmählich gewann der Papst wirkliche Macht über die Stadt, über die angrenzenden Territorien und sogar über die zum Christentum bekehrten barbarischen Könige. Dabei wurde er vollständig unabhängig vom Kaiser in Konstantinopel. Wichtiger noch war, dass sich die zwei Zentren der Christenheit kirchenorganisatorisch, liturgisch und dogmatisch voneinander entfernten. Verantwortlich für die entstehenden Differenzen waren wohl eher die Missverständnisse, zu denen es infolge des langsamen Auseinanderdriftens der Sprachen und der Kulturen kam, als eine bewusste Politik, die darauf gezielt hätte, die lateinische von der griechischen Christenheit zu trennen und zwischen beiden Zwist zu schüren. Am Ende aber stand das Zerwürfnis. Seit dem elften Jahrhundert betrachteten sich Katholiken und Orthodoxe wechselseitig als Abtrünnige, und die Feindseligkeit, mit der letztere den ersteren begegneten, steigerte sich dank des berüchtigten vierten Kreuzzuges zu Beginn des 13. Jahrhunderts zum offenen Hass.
Zu diesem Zeitpunkt war der Kontinent schon fast völlig christianisiert und in zwei Einflusssphären aufgeteilt, die von Rom und die von Konstantinopel, wobei die Trennlinie vom Weißen Meer bis zur Adria verlief und bis heute eine wichtige kulturelle und religiöse Grenze geblieben ist. Sie beginnt östlich von Finnland, folgt dann der Ostgrenze des Baltikums, durchquert Weißrussland, die Ukraine und Rumänien und endet zwischen Kroatien und Serbien. Zehn Jahrhunderte lang blieb sie unverrückt; die erstaunliche Stabilität, mit der sie allen Versuchen, sie in die eine oder andere Richtung zu verschieben, getrotzt hat, verdient Bewunderung. Die beiden Einflusssphären unterschieden sich nicht nur in der Art und Weise, wie sie den christlichen Glauben praktizierten, sondern auch in kulturellen Belangen. Etwa im Verhältnis zu Bildern, wo sich in den Gebieten der orthodoxen Kirchen die Bilderstürmerei langfristig auswirkte, wohingegen die katholischen Gebiete eher einen Bilderkult entwickelten. Oder hinsichtlich der Volks- und Landessprachen, die in den orthodoxen Regionen früher als in den katholischen Anerkennung fanden und gepflegt wurden: Es entstand ein der Phonetik dieser Sprachen angepasstes Alphabet, Übersetzungen aus dem Griechischen waren ziemlich verbreitet, und so kam es zu einer frühen Blüte der Literatur und Geschichtsschreibung. Und schließlich hinsichtlich der Kultur der Antike, die in Byzanz in Gestalt originaler Werke aus den Bereichen der bildenden Kunst sowie der Philosophie, der Naturwissenschaften, der Dichtung und der Prosaliteratur präsent war, wohingegen der Westen im Wesentlichen nur Zugang zu späteren römischen Nachbildungen und ein paar Übersetzungen aus dem Griechischen ins Lateinische hatte.
Ost und West unterschieden sich darüber hinaus hinsichtlich der kaiserlichen Macht, der die politische Doktrin des byzantinischen Reichs größeren Einfluss in geistlichen Fragen einräumte, als Kaiser oder Könige im Westen beanspruchen konnten. Und hinzu kam schließlich noch, dass sich das byzantinische Reich als einziger legitimer Erbe des Römischen Reichs und als ihm gleichartig betrachtete, im Unterschied zu den römisch-christlichen Führungsschichten, die sich dem alten Rom und dem Byzantinischen Reich kulturell unterlegen fühlten und alles daransetzten, Ebenbürtigkeit zu erlangen. Daher die renovatio imperii Romani, die Renaissance-Bewegungen in der Bildenden Kunst und in der Literatur, die seit dem zwölften Jahrhundert betriebenen Übersetzungen aus dem Arabischen und aus dem Griechischen, die Aufnahme der aristotelischen Lehren in den Lehrplan der Universität im 13. Jahrhundert und das zunehmende Interesse an der klassischen Antike, das in der vom 14. bis zum 16. Jahrhundert währenden Renaissance gipfelte, die sich von Italien in alle Länder des römisch-lateinischen Westens ausbreitete.
In den Anfang des 13. Jahrhunderts fallen zwei Ereignisse, die das Verhältnis zwischen östlicher und westlicher Christenheit radikal und für lange Zeit veränderten. Das eine Ereignis war der erwähnte vierte Kreuzzug, in dessen Verlauf Konstantinopel erobert, das Byzantinische Reich für ein paar Jahrzehnte durch das Lateinische Kaiserreich des Ostens ersetzt und dadurch der Boden für die Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen bereitet wurde. Das zweite Ereignis, das ungefähr 20 Jahre später eintrat, war der Einfall der Mongolen in die christlichen Gebiete. Als der Tod des Mongolenherrschers den mongolischen Vormarsch stoppte, war bereits die Kiewer Rus zerstört und alles Land östlich des Dnjepr in mongolischer Hand. Die Mongolen herrschten dort fast drei Jahrhunderte lang, aber die Auswirkungen waren weit langfristiger.
Das Moskauer Fürstentum, das unter mongolischer Oberherrschaft entstand, blieb auch nach seiner Unabhängigkeit und seiner Überführung ins Zarenreich vom Westen getrennt, abgesehen von gelegentlichen Kontakten, zu denen es zumeist auf dem Schlachtfeld kam. Der ganze Nordteil des Territoriums der orthodoxen Kirche lebte deshalb bis zum Ende des 17. Jahrhunderts, also grob gesprochen ein halbes Jahrtausend lang, in Ungleichzeitigkeit mit der lateinischen Christenheit. Etwa zwei Jahrhunderte später kam es im Süden zu einem ähnlichen Bruch, als die Eroberung der auf dem Balkan gelegenen früheren byzantinischen Gebiete durch die türkischen Osmanen mit dem Fall Konstantinopels und dem Untergang des Byzantinischen Reiches selbst endete. Auch die Trennung dieser Regionen von der lateinischen Christenheit und später von Europa währte ungefähr ein halbes Jahrtausend, bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts.
Für die lateinische Christenheit war das eine Zeit voller Innovationen, nicht nur im Bereich technischer Entwicklungen auf der Basis von Erfindungen, die von “draußen” entlehnt wurden – unter anderem seien hier der Kompass, das Papier, das Schießpulver und die Druckerpresse genannt –, sondern auch in Politik, Gesellschaftsordnung, Wirtschaft und Kultur: man denke etwa an städtische Selbstverwaltung, Universitäten und Parlamente. Besonders wichtig für die Frage, um deren Beantwortung es mir geht, ist die Tatsache, dass diese Innovationen sich im ganzen Gebiet der lateinischen Christenheit verbreiteten, auch wenn sie in den westlichen Kernregionen häufiger vorhanden und tiefer verwurzelt waren als in den östlichen Randgebieten, wo der Katholizismus mit der Orthodoxie und später dem Islam zusammentraf. Ungeachtet dieser internen Unterschiede erreichte die lateinische Christenheit zwischen dem zwölften und dem beginnenden 16. Jahrhundert ein sehr hohes Niveau religiöser und ergo auch kultureller Einheit. Überall war die zum Zölibat verpflichtete Geistlichkeit in einer Hierarchie organisiert, mit einem Bischof an der Spitze der Diözesen und dem Papst als dem Oberhaupt aller Katholiken. Überall zelebrierten die Priester die gleiche Liturgie. Überall waren die gleichen religiösen Orden tätig. Überall verständigten sich die Gebildeten auf Latein und bezogen sich auf die gleichen Quellen – die Vulgata, die Kirchenväter, Aristoteles und seine arabischen Kommentatoren, das Römische Recht, die großen Gewährsleute der scholastischen Theologie –, und überall folgten die Lehranstalten, Schulen und Universitäten den gleichen Lehrplänen. In der bildenden Kunst ähnelten sich die für Bildwerke, Gobelins und Miniaturen maßgebenden Motive, und überall hatte die Architektur, die wir die “gotische” nennen, eine solche Verbindlichkeit, dass ihre räumliche Ausdehnung deckungsgleich ist mit dem Verbreitungsgebiet der lateinischen Christenheit.
Außerdem kam es in allen Ländern zur Entstehung souveräner Staaten und zur Ausbildung eines Nationalbewusstseins – auch wenn sich dies auf verschiedene Weise und in unterschiedlichem Tempo vollzog. Und in allen Ländern trat der souveräne Staat in den Dienst dynastischen Ehrgeizes und territorialer Expansionsbestrebungen, mit dem Ergebnis eines fast permanenten Kriegszustandes. Jeder der souveränen Staaten wehrte sich gegen die Bemühungen des Reiches und später der Kirche, die lateinische Christenheit zu befrieden und sie unter kaiserlicher und später dann päpstlicher Oberhoheit zu vereinigen, zwecks Schaffung der wahren Christlichen Republik. Und hierbei fand der souveräne Staat die Unterstützung einiger Fraktionen der Geistlichkeit, des Adels, des Juristenstands und der Kaufmannschaft. Diese zentrifugalen Kräfte erstarkten ganz besonders während des großen westlichen Schismas, bei dem sich ein Papst in Avignon und einer in Rom gegenüberstanden. Die ersten Versuche zur Verstaatlichung der Religion wurden in England, in Frankreich und in Böhmen unternommen, wo es zur Gründung einer Nationalkirche kam. Nachdem zwei allgemeine Konzile dem Durcheinander an der Spitze der Kirche eine Ende gesetzt hatten, schien alles wieder seinen durch die Spannung zwischen souveränem Staat und Papsttum geprägten Gang zu gehen, wobei diese Spannung manchmal in einen offenen Konflikt ausarten konnte, gewöhnlich aber durch einen Kompromiss beigelegt wurde.
III
Luthers Reformation schien anfangs nach dem üblichen Muster zu verlaufen. Es kam indes anders. Mittels der Druckerpresse propagiert, breitete sie sich binnen weniger Jahre durch den deutschsprachigen Raum und durch Skandinavien aus, zog ähnliche Bewegungen in der Schweiz und in Frankreich nach sich, rief den Bruch zwischen England und dem Papsttum hervor, drang in die Niederlande, nach Schottland, Polen und Transsylvanien vor. Seit den zwanziger Jahren des 16. Jahrhunderts wird die Christenheit von Religionskriegen heimgesucht – von außerordentlich gewalttätigen und barbarischen Bürgerkriegen in einzelnen Ländern und von nicht weniger gewalttätigen und barbarischen Kriegen zwischen protestantischen und katholischen Staaten. Unterbrochen von Zeiten des Waffenstillstands dauern diese Kriege bis ins erste Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts. Bereits Mitte des 17. Jahrhunderts freilich war hellsichtigen Beobachter klar, dass die lateinische Christenheit unwiderruflich der Vergangenheit angehörte. Fortan gab es zwei Koalitionen: die der katholischen Gegenreformation unter Führung des Papsttums und der Habsburger Monarchie und die der protestantischen Länder, die zuerst von Frankreich unterstützt und im letzten Akt des Konflikts dann von England und den Niederlanden finanziert und gegen Frankreich eingesetzt wurde.
Wir kommen nun zum entscheidenden Augenblick: der Geburt Europas aus dem Geiste der Aufklärung. Tatsächlich geschah es während des letzten Akts der Religionskriege, in den letzten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts, dass sich eine neue, die Schranken der Konfessionen und Nationen überschreitende Gemeinschaft bildete und die Vielzahl souveräner Staaten und unvereinbarer Glaubensrichtungen überlagerte, wobei sie im Gegensatz zur alten christianitas ihre Grundlage nicht im gemeinsamen Glauben, sondern in der gemeinsamen Kultur fand, die gleichermaßen katholische Kollegien und protestantische Gymnasien den gebildeten Führungsschichten vermittelten. Die Schüler beider Bildungseinrichtungen sprachen dieselbe Sprache, Latein, und in zunehmendem Maße Französisch, sie waren vertraut mit derselben christlichen Überlieferung, auch wenn sie diese auf vielerlei Weise interpretierten, mit denselben klassischen Autoren und den von der klassischen Antike hinterlassenen historischen und künstlerischen Denkmälern. Auf der Suche nach neuen Regeln für das Zusammenleben der Kräfte, die auf dem Kontinent miteinander im Streit lagen, konnten die weltlichen Führungsschichten nur aus diesem gemeinsamen Erbe schöpfen.
Um die Gesetzmäßigkeiten von Krieg und Frieden genauer herauszuarbeiten, wandten sie sich deshalb Beispielen und Vorbildern aus der Geschichte Israels und der römischen Geschichte zu. Weil sie sich nicht länger auf eine gemeinsame Offenbarung stützen konnten, beriefen sie sich mit anderen Worten auf ein Naturrecht, das sie begrifflich zu erfassen suchten. Und dieses neue Recht bemühten sie sich ebensosehr, bei Friedensverhandlungen zur Geltung zu bringen, wie sie sie es in gelehrten Abhandlungen entfalteten, bei deren Verfassern es sich zumeist um Personen handelte, die als Juristen oder Diplomaten oder in beiden Eigenschaften tätig waren. Das ius gentium, das aus diesen Bemühungen hervorging, verlieh dem Namen Europa eine neue Bedeutung. Er bezeichnete fortan eine Gemeinschaft von Staaten, die das Völkerrecht anerkennen, selbst wenn sie es in Verfolgung eigensüchtiger Interessen immer wieder verletzen. Europa war indes mehr als das ius gentium. Es bildete zugleich ein Gleichgewicht der Kräfte, das durch eine geschickte Diplomatie aufrechterhalten wurde, die imstande war, Koalitionen ins Leben zu rufen, die jedem Einzelstaat überlegen und damit in der Lage waren, entweder den Frieden zu erhalten oder aber den Krieg zu gewinnen. Außerdem stellte Europa einen Bezugsrahmen dar, auf den sich Individuen und Staaten als auf eine Art gemeinsame Heimat berufen konnten. Und es verkörperte eine geistige Gemeinschaft von Menschen, die eine profunde Kenntnis der Literatur und Kunst der klassischen Antike und Bewunderung für sie einte und die beanspruchten, sich in ihren historischen oder wissenschaftlichen Forschungen und in ihrem praktischen Verhalten von den Geboten der Vernunft leiten zu lassen. Eine solche Gemeinschaft – res publica litteraria, République des Lettres, Republic of Learning oder Gelehrtenrepublik – unterstellte ihre Mitglieder klaren Regeln, die zusammen eine Ethik bildeten, deren Grundlage nicht die Offenbarung, sondern das lumen naturale war und die insofern dem Völkerrecht nahestand. Sowohl die souveränen Staaten als auch Europa sind demnach komplementäre Erzeugnisse des gleichen Säkularisierungsprozesses.
Vom Christentum in die Tat umgesetzt, führte die erste kulturelle Einigung des europäischen Kontinents in seinem lateinischen Teil zur Schaffung der christianitas. Die zweite kulturelle Einigung dessen, was wir mit Recht als Europa bezeichnen dürfen, vollzieht sich unter dem Banner der Aufklärung. Sie gipfelt in der Französischen Revolution und im Versuch Napoleons, ein europäisches Reich zu schaffen, in dem überall die gleichen Verwaltungsstrukturen, das gleiche bürgerliche Recht, das gleiche System von Gewichten und Maßen, das gleiche Bildungswesen und die gleiche Museumskultur herrschen. Das napoleonische Reich währte nicht lange, wenngleich uns einige seiner Errungenschaften bis heute erhalten geblieben sind. Die zweite kulturelle Einigung kulminierte freilich auch in der industriellen Revolution, die Anfang des 18. Jahrhunderts in Großbritannien in Gang kam und sich im 19. und 20. Jahrhundert über den ganzen Kontinent ausbreitete. Sie veränderte die sozialen Hierarchien und ließ an die Stelle der Stände Klassen treten, die ihre Konflikte im Rahmen des Interessengegensatzes zwischen Bürgertum und Proletariat austrugen. Sie stellte das Verhältnis zwischen Stadt und Land auf den Kopf, veränderte nachdrücklich den Lebensraum der Menschen, ihre Arbeit und ihre Freizeit, das Leben im Frieden und die Kriegsführung. Und sie vollendete den jahrhundertelangen Prozess der Ersetzung religiöser kollektiver Glaubensvorstellungen durch neuartige Überzeugungen, die den irreführenden Namen Ideologie erhielten und die im Unterschied zur Religion nicht auf eine andere Welt und die Ewigkeit, sondern auf die diesseitige Welt und die Zukunft gemünzt waren.
Die kombinierte Wirkung beider Revolutionen, verstärkt noch durch die Dynamik zündender und radikalisierender Ideologien, revolutionierte wiederum das Verhältnis zwischen Führungsschichten und Massen. In jedem einzelnen Land wurde der Gegensatz zwischen der kosmopolitischen, sprich, europäischen Kultur der Führungsschichten und der bodenständigen Kultur der breiten Masse – erstere säkularisiert und Neuerungen gegenüber aufgeschlossen, letztere von der Religion geprägt und traditionsgebunden – durch die Aufklärung verschärft, ehe er in neuen Nationalkulturen gleichsam seine Auflösung fand. Die Idee einer Nationalkultur als solche stammt aus dieser Zeit; zuvor war Kultur ihrem eigensten Verständnis nach universal. Und die Nationalisierung der Kultur resultierte schließlich, nach über einem Jahrhundert erbitterter Auseinandersetzungen, in der Nationalisierung oder Demokratisierung der Politik: der Politisierung der Massen durch die Ausübung des allgemeinen Wahlrechts und vermittels politischer Parteien.
Die wachsende Rolle des Nationalbewusstseins hatte Einfluss auf die zwischenstaatlichen Beziehungen, die erst jetzt zu internationalen im eigentlichen Sinne wurden. Sie führte zu einer Neuordnung der politischen Landkarte Europas, wo die Zahl der unabhängigen Staaten – bei denen es sich fast durchweg um Nationalstaaten handelte – zuerst, zwischen 1815 und 1870, aufgrund des Einigungsprozesses in Deutschland und Italien rückläufig war und anschließend wieder zu steigen begann. Zwischen 1870 und 1990 stieg sie von 20 auf 41, wobei die meisten neuen Staaten in Zentral- und Osteuropa entstanden, und zwar infolge der Auflösung früherer Reichsverbände nach einem verlorenen Krieg – wie im Falle der Habsburger Monarchie, des Deutschen Reiches, des Zarenreiches und des Osmanischen Reiches – oder durch friedlichen Zerfall – wie bei der Sowjetunion. Die wachsende Bedeutung der Nationalidee und nationalistischer Ideologien trug außerdem seit den siebziger Jahren des 19. Jahrhunderts zur Entstehung ständiger Spannungen zwischen Staaten bei, die sich mit separatistischen Bewegungen innerhalb ihrer Grenzen und mit Ansprüchen der Nachbarn auf Teile ihres Territoriums konfrontiert sahen.
In einem Klima des Rüstungswettlaufs, des Wettstreits um Kolonien und einer Bündnispolitik, die das europäische Kräftegleichgewicht aufrechterhalten sollte, sich tatsächlich aber im Sinne seiner Zerstörung auswirkte, genügte ein Funke, um eine gewaltige Explosion auszulösen. 1914 kam es zu dieser Explosion, deren Folgen bis 1990 reichten: vier Jahre Grabenkrieg, die bolschewistische Revolution in Russland, der Friedensvertrag von Versailles, den Deutschland und die neue Sowjetmacht ablehnten, die faschistische Machtergreifung in Italien, die Weltwirtschaftskrise von 1929, die Machtergreifung Hitlers und seiner Nationalsozialistischen Partei in Deutschland, der Zweite Weltkrieg mit der Vernichtung des europäischen Judentums, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und dann der “Eiserne Vorhang”, der stalinistische Totalitarismus, dem fast alle Länder Mittel- und Osteuropas zum Opfer fielen, der Kalte Krieg und der langsame Zerfall des sowjetischen Systems bis zu seinem schließlichen Untergang.
Nicht einmal all die Greueltaten des 20. Jahrhunderts indes schafften es, die Ergebnisse der zweiten kulturellen Einigung Europas zunichte zu machen. Diese erlebte sogar eine Ausdehnung und Vertiefung: durch das Netz von Eisenbahnen, Fernstraßen und neuen Kommunikationsmitteln, durch die Ausbreitung der Industrie, das Wachstum der großen Städte, die Fortschritte in der Alphabetisierung und Volksbildung, kurz, durch eine immer größere Vereinheitlichung der Lebensbedingungen und des materiellen Daseins. Zu den bleibenden Resultaten der zweiten kulturellen Revolution zählte außerdem die Idee von Europa als einer kulturellen Realität – eine Idee, die beträchtliche Teile der Führungsschichten in den meisten europäischen Nationen seit dem 18. Jahrhundert hegten und zunehmend mit der Überzeugung verknüpften, dass diese kulturelle Realität auch ökonomisch und sogar politisch Gestalt gewinnen müsse. Bereits nach dem Ersten Weltkrieg wurden von einflussreichen Politikern, Literaten und Intellektuellen verschiedene Anstrengungen in dieser Richtung unternommen. In einer von heftigen ideologischen Auseinandersetzungen, Misstrauen zwischen den Staaten und ökonomischen Krisen geprägten Atmosphäre scheiterten sie freilich alle.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden sie wiederaufgenommen, und diesmal hatten sie Erfolg. Die Jahrzehnte wirtschaftlicher und politischer Integration im westlichen Europa ermöglichten zuerst in Griechenland, Portugal und Spanien den friedlichen Übergang zur Demokratie und später eine völlig unerwartete friedliche Entmachtung der kommunistischen Regime in den Ländern des Sowjetblocks. Europa ist heute in einem Maße vereint wie nie zuvor. Die tiefe Kluft zwischen dem ökonomischen Niveau im westlichen Europa einerseits und in den meisten Ländern Mittel- und Osteuropas andererseits wird sich nicht so rasch schließen lassen. Aber eine ideologische Spaltung zwischen liberalen und autoritären Ländern wie vor 1914 oder zwischen demokratischen und totalitären Staaten wie nach dem Ersten Weltkrieg existiert nicht mehr. Und es gibt keine Spaltung mehr zwischen Marktwirtschaften und sogenannten Planwirtschaften. Es stimmt, dass neue Trennlinien in Erscheinung treten – die vielleicht wichtigste ist die zwischen den Mitgliedern der Europäischen Union und Ländern, die der Union gern beitreten würden, aber die Aufnahmebedingungen nicht erfüllen. Den Eindruck, dass sie in einem gewalttätigen Konflikt resultieren könnte, macht diese Differenz freilich nicht.
IV
Unser Exkurs in die Vergangenheit erklärt, wie ich hoffe, beides: die Vielgestaltigkeit und die Einheit Europas. Er lässt mit anderen Worten die spezifischen Merkmale Europas deutlich werden und mithin das, was Europa von den Territorien der Muslime und der Chinesen mit ihrer weitgehend eigenen Geschichte unterscheidet. Es dürfte aufgefallen sein, dass ich von Unterschieden spreche, es aber vermeide, von Identität zu reden. Bei den Unterschieden bewegen wir uns auf dem Boden der Empirie; wir wissen, wie wir vorgehen müssen, um den behaupteten Unterschied, sagen wir, zwischen Europa und China nachzuweisen. Bei der Identität verhält sich das anders. Der Begriff Identität entstammt einer Fachsprache, in der er in dem von Leibniz definierten strengen Sinn Verwendung findet: eadem sunt quorum unum potest substitui alteri salva veritate (identisch sind Elemente, bei denen ohne Einbuße an Wahrheit eins das andere ersetzen kann). Außerhalb des Feldes der Mathematik und Logik indes begegnen wir keiner Identität, sondern bloß mehr oder minder weitgehender Ähnlichkeit. Dennoch hat der Begriff Identität heute Einzug ins Vokabular von Sozialwissenschaftlern, Historikern, Journalisten und sogar Politikern gehalten. Warum hat er in den letzten rund 20 Jahren derart Karriere gemacht? Was wollen Menschen ausdrücken, wenn sie ihn verwenden? Worum geht es ihnen, wenn sie erklären, sie müssten ihre Identität vor Bedrohungen schützen, denen sie ihrer Meinung nach ausgesetzt ist?
Wenn wir uns das Bedeutungsspektrum ansehen, das der Begriff Identität im heutigen alltäglichen Sprachgebrauch hat, dann fällt sofort seine enge Verknüpfung mit der Vorstellung von Stabilität auf. Identität bezeichnet etwas, das nicht schnell vergänglich ist, das vielmehr in seiner wesentlichen Beschaffenheit dem Zeitfluss trotzt. In diesem Sinne verstanden, entspricht der Begriff in etwa dem, was Braudel la longue durée nennt. Aber Identität steht darüber hinaus in enger Beziehung zu zwei anderen Begriffen, die ebenfalls in den letzten 20 Jahren sehr in Mode gekommen sind. Gemeint sind die Begriffe Erinnerung und Tradition. Das weist auf eine starke Verknüpfung zwischen Identität und Vergangenheit hin. Und in der Tat existiert eine solche Verknüpfung. Wenn wir von Identität sprechen, dann sprechen wir von dem, was uns unsere Vorfahren hinterlassen haben. So verstanden, lassen sich all die Unterschiede zwischen Europa und seinen Nachbarn, die ich zu Beginn meiner Erörterung aufgelistet habe, als Komponenten der europäischen Identität ansehen. Wenn das Wort “Identität” in diesem deskriptiven Sinne gebraucht wird, hat es im Vokabular des Historikers seinen legitimen Platz. Demnach bin ich in der Lage, die erste der anfänglich gestellten Fragen ohne Wenn und Aber zu beantworten. Jawohl, es lässt sich – und zwar mit guten Gründen – von einer historisch gewordenen, europäischen Identität sprechen, durch die sich Europa vom Rest der Welt unterscheidet.
Wie aber steht es nun um die andere unserer anfänglichen beiden Fragen, um die Frage nämlich, ob für die Europäer diese ihre Identität zukunftsweisende Bedeutung haben kann? Wie in der Formulierung bereits impliziert, wird hier unter Identität etwas verstanden, das wir an unsere Nachkommen weitergeben werden. Zumal wenn wir uns Sorgen um unsere Identität machen, sorgen wir uns nicht so sehr um etwas, das wir bereits geerbt haben, sondern um etwas, das unsere Nachkommen von uns erben werden. Wir sorgen uns nicht so sehr um das, was wir selbst sind, sondern um das, was sie sein werden. Auch wenn wir nicht erwarten, dass sie unsere perfekten Ebenbilder sind, wollen wir doch, das sie uns in wesentlichen Punkten ähnlich sind, dass zwischen uns und ihnen eine Kontinuität erhalten bleibt. “Identität” im gängigen Sprachgebrauch bezieht sich demnach weniger auf unser Verhältnis zur Vergangenheit als auf unseren Bezug zur Zukunft. Dass freilich die Vergangenheit irgendwie in diesem Bezug enthalten ist, liegt auf der Hand. Genau genommen, lässt sich also sagen, dass “Identität” gemeinhin unseren Bezug zur Gegenwart vermittels der Vergangenheit betrifft.
Es gab Zeiten, in denen unser Bezug zur Zukunft nicht notwendig der Vermittlung durch die Vergangenheit bedurfte. Heute indes müssen wir uns gerade dann, wenn wir in Großprojekte investieren, die erst in ferner Zukunft Gewinn bringen werden, insofern Gedanken um die Vergangenheit machen, als wir die Umwelt schützen müssen, die ja nichts anderes ist als die materialisierte Vergangenheit. Wenn wir Projekte machen und Aktionen unternehmen, die geeignet sind, das Leben der Menschen auf Jahre hinaus zu beeinflussen, dann nehmen wir nolens volens eine Haltung zur Vergangenheit ein. Diese Haltung zur Vergangenheit entwickelt sich auf zwei Ebenen. Die eine Ebene ist die Sozialisierung der Kinder im Rahmen der Familie, wo Eltern den Kindern nicht nur ihre Sprache, sondern auch ihre Gesten, mimischen Ausdrucksweisen, Einstellungen, Überzeugungen und Vorurteile einprägen – häufig, ohne sich dessen bewusst zu sein. Damit geben sie ein immaterielles und materielles Erbe bzw. von ihnen bewusst oder unbewusst ausgewählte Teile des Erbes an ihre Kinder weiter. In unveränderter Form wird das Erbe niemals weitergereicht. Jede folgende Generation fügt dem, was sie erhalten hat, etwas hinzu und tilgt Dinge, die sie für irrelevant, uninteressant, überholt hält. All das geschieht spontan, im alltäglichen Leben, ohne dass sich die Menschen im mindesten bewusst sind, dass ihr Verhalten den Tatbestand dessen erfüllt, was die Sprache der Gebildeten unter Wahrung der Identität versteht.
Die andere Ebene, auf der die Menschen ihren Bezug zur Zukunft mittels der Vergangenheit konkretisieren, ist der Bereich der Politik: des durch Programme, die in Ministerien oder anderen staatlichen Ämtern entwickelt werden, geregelten Schulunterrichts in Fächern wie Sprache, Geschichte, Literatur, Kunst, Religion, Sozialkunde oder Ethik; der Pflege der Sprache des Landes, seiner Landschaften, Denkmäler, Museen, Archive, Bibliotheken und aller anderen Bestandteile seines materiellen Erbes; der Erhaltung der von der Bevölkerung in ihrer Mehrheit hochgehaltenen Traditionen; der Sorge dafür, dass jene Gesetze und Bräuche respektiert werden, die zu Recht oder zu Unrecht als wesentlich für die Aufrechterhaltung des sozialen Zusammenhalts und vor allem für den Brückenschlag zwischen der gegenwärtigen Generation und den ihr nachfolgenden gelten. Alle Maßnahmen, die auf die Erziehung, das kollektive Gedächtnis und das Selbstbild einwirken, das die Menschen von sich haben und ihren Nachkommen überliefern möchten, bilden zusammengenommen die Politik der Identität, auch wenn sie nicht amtlich unter diesem Namen firmiert. Im Gegensatz zu dem, was sich auf der Ebene der Familie abspielt, ist diese Politik zwangsläufig Gegenstand eines öffentlichen Reflexionprozesses und muss auf dem Wege demokratischer Entscheidungsbildung in die Tat umgesetzt werden.
Ebenso verhält es sich in den Ländern Europas. Dennoch ist für die gegenwärtige Situation charakteristisch, dass sich in wachsenden Teilen der Bevölkerung das Bewusstsein einer Diskrepanz zwischen den beiden Ebenen der Herstellung von Identität – der öffentlichen und der privaten – verbreitet. Was die Menschen tun, wenn sie ihre Kinder erziehen, scheint ihnen mit anderen Worten dem nicht zu entsprechen oder gar zuwiderzulaufen, was die staatlichen Einrichtungen unternehmen, um die Zukunft des Landes und Europas zu gestalten. Wenn diese Einschätzung zutrifft, ist unschwer verständlich, warum die Debatten um die Frage der Identität so hitzig geführt werden. Zugleich ist festzuhalten, dass diese Debatten nicht in die Zuständigkeit des Historikers fallen.
Ein Historiker kann beurteilen, worin im deskriptiven Sinne – also in Gestalt eines Clusters von stabilen Unterscheidungsmerkmalen – die Identität eines Landes oder auch Europas besteht. Er kann außerdem feststellen, dass die Europäer in ihrer Mehrzahl unsere zweite anfängliche Frage im Sinne des Bemühens beantworten, der europäischen Identität bzw. dem, was sie dafür halten, eine zukunftsweisende Bedeutung abzugewinnen. In diesem Punkte scheint es eine ziemlich weitreichende Übereinstimmung zu geben, ungeachtet des abweichenden Votums einiger Denker, die bereit sind, sich der europäischen Identität zu entledigen, egal, welchen Inhalts sie ist. Der Kernpunkt der Debatte indes liegt anderswo. Er betrifft Identität nicht im deskriptiven, sondern im präskriptiven Sinne. Die eigentliche Streitfrage lautet: Vorausgesetzt, dass wir sind, wer wir sind – was von unserer Vergangenheit und unserer Gegenwart gilt uns als erhaltenswert? Was sind wir bereit aufzugeben, und woran hängen wir so stark, dass wir es uns unter keinen Umständen rauben lassen wollen? In welchem Umfang muss die Zukunft unseren in der Vergangenheit wurzelnden Erwartungen entsprechen, und wie weit sind wir bereit, die Gestaltung der Zukunft Kräften anheimzustellen, über die wir keine Kontrolle haben und die allem Anschein nach bewirken, dass sich diese Zukunft unserer vertrauten Vorstellung von ihr zunehmend entfremdet? All diese Fragen werden im heutigen Europa in vielerlei verschiedenen Formen diskutiert. Und sie alle sind nicht dem Historiker, sondern in erster Linie dem Politiker und in letzter Instanz der europäischen Bürgerschaft zu stellen, die als oberster Entscheidungsträger die Antwort auf sie geben muss.
Die europäische Identität ist eine historische Tatsache. Sie erweist sich aber auch mehr und mehr als ein politisches Problem.
Published 24 August 2009
Original in Dutch
Translated by
Ulrich Enderwitz
First published by L. Ornstein and L. Breemer (eds.), Paleis Europa. Grote denkers over Europa, as "De Europese identiteit : een historisch feit en een politiek problem", De Bezige Bij: Amsterdam 2007, 29-54 (Dutch version); Transit 37 (2009) (German version).
Contributed by Transit © Krzysztof Pomian / Transit / Eurozine
PDF/PRINTNewsletter
Subscribe to know what’s worth thinking about.



