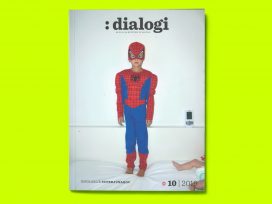
Searching for superheroes
Dialogi 10/2019
Dialogi analyses superhero narratives East and West: from Slovene romanticism to post-communist spoof and the neo-con blockbuster.
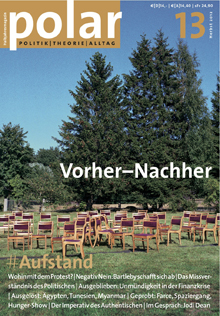 Dass etwas authentisch sei, ist in den meisten Diskursen noch immer ein Ausdruck der Hochschätzung, in anderen gibt es aber schon seit ungefähr 30 Jahren – siehe: die Rockism-Debatte im britischen New Musical Express um 1981/82 – eine kritische Auseinandersetzung mit dem Fetisch der Echtheit, der einem gerade dort so oft begegnet, wo etwas massenhaft verkauft werden soll. Dabei ist dieses Urteil – dass etwas authentisch sei – also in Bezug auf etwas Anderes ungelogen, unverstellt, echt meist nie klar als ein ästhetisches oder ethisches Urteil gekennzeichnet. Es gehorcht fast immer einer Strategie, die ästhetische und ethische Perspektiven gezielt vermischt, die ethisch beurteilt, was ästhetisch gerahmt ist und umgekehrt. Für solche Strategien gibt es durchaus auch ein paar gute und meistens aber viele schlechte Gründe, abhängig von ihren Kontexten und Zielen. Für jede weitere Diskussion von Urteilen des Typus “Das ist authentisch!” bleibt indes entscheidend, wo und vor allem wann man diesem Ideologem der Authentizität begegnet; ob in der Kunst und in welcher, ob in der Produktwerbung oder gar in der Psychologie, als Lebensmaxime der 50er , der 70er oder der Gegenwart, bei Artaud, bei Joe Cocker oder bei Big Brother, am Stammtisch oder in den social media.
Dass etwas authentisch sei, ist in den meisten Diskursen noch immer ein Ausdruck der Hochschätzung, in anderen gibt es aber schon seit ungefähr 30 Jahren – siehe: die Rockism-Debatte im britischen New Musical Express um 1981/82 – eine kritische Auseinandersetzung mit dem Fetisch der Echtheit, der einem gerade dort so oft begegnet, wo etwas massenhaft verkauft werden soll. Dabei ist dieses Urteil – dass etwas authentisch sei – also in Bezug auf etwas Anderes ungelogen, unverstellt, echt meist nie klar als ein ästhetisches oder ethisches Urteil gekennzeichnet. Es gehorcht fast immer einer Strategie, die ästhetische und ethische Perspektiven gezielt vermischt, die ethisch beurteilt, was ästhetisch gerahmt ist und umgekehrt. Für solche Strategien gibt es durchaus auch ein paar gute und meistens aber viele schlechte Gründe, abhängig von ihren Kontexten und Zielen. Für jede weitere Diskussion von Urteilen des Typus “Das ist authentisch!” bleibt indes entscheidend, wo und vor allem wann man diesem Ideologem der Authentizität begegnet; ob in der Kunst und in welcher, ob in der Produktwerbung oder gar in der Psychologie, als Lebensmaxime der 50er , der 70er oder der Gegenwart, bei Artaud, bei Joe Cocker oder bei Big Brother, am Stammtisch oder in den social media.
Meine erste These wird darauf hinauslaufen, dass Authentizität sich als Kampfbegriff überhaupt nur dort entwickeln konnte, wo etwas durchgesetzt werden muss, dessen begründende Werte längst durchgesetzt sind. Authentizität als Wert begründet darum so oft die klassischen und dennoch immer wieder neu ausgetragenen Kämpfe gegen Doppelmoral: vom Kampf gegen die bürgerliche Lebenslüge bis zur sich nicht verbiegenden Bio-Bäuerin in einer ARD-Öko-Heimatschnulze. Wo es aber um Erneuerungen und Unerhörtes geht, taugt Authentizität als Kampfbegriff nicht: da setzen dann die Diskurse der Kreativität, des Artifiziellen und der Innovation ein. Beide können unter bestimmten Umständen normativ werden und ihren einklagenden oder transformatorischen Charakter nicht nur verlieren, sondern erleben, dass gerade weil ihnen Klagevertretung oder Transformation zugetraut wird, die Treue zu sich selbst wie die Bereitschaft zur Selbstveränderung gegen deren ursprüngliche Ziele eingesetzt wird – etwa in dem ihr politisch gesellschaftlicher Charakter zu einem individuell privaten Lebensstil herabsackt. Das wäre eine zweite These: Kodifizierte Signale oder Indizes der Authentizität (Schweiß, Blut, resoluter Gesichtsausdruck) legitimieren eine ehemals politische, gesellschaftliche Position (ökologisches Handeln) auf der Ebene von Moral und reaktionärer Charakterologie (lässt sich nicht verbiegen).
Authentizität lässt sich als zustimmendes, lobendes Urteil nur über solche Dinge konstatieren, die erstens in Gefahr sind nicht eins zu sein und bei denen es zweitens Gründe gibt, warum es nicht gut ist, wenn ihre Struktur nicht aus lauter Gleichheitszeichen besteht. Wenn man sich klar machen will, warum – wie bei dieser Veranstaltung – überhaupt vom Authentizitätsterror die Rede sein kann, muss man zunächst versuchen sich vorzustellen, wie das war, als man nicht authentisch sein konnte oder durfte, bzw. was damit gemeint war, wenn jemand Entsprechendes beklagte. Authentisch sein zu wollen, entstand als ein so genanntes Bedürfnis in den späten 1950er Jahren und schrieb sich dann durch die Rock-Kultur und andere vor allem weiße, männliche und heterosexuelle Befreiungserzählungen fort. Es war aber ein Bedürfnis, ein einstweilen uneingelöstes, ja utopisches, keine Norm, keine Verpflichtung, kein Zwang.
Zu dieser Konstellation gehört, dass das konformistische, heterosexuelle, männliche Genießen, das Selbstbewusstsein des arbeitenden, einigermaßen gut bezahlten Angehörigen der weißen Mehrheitsgesellschaft eigentlich schon als durchgesetzt und gutes Recht jedes Mitglieds dieser Gruppe gilt, aber dann doch merkwürdige Spannungen, Neurosen, Angstzustände und Ausraster auftauchen und Katzen über heiße Blechdächer hetzen. Man ist als eigentlich doch stolzer Mann nur ein notgedrungen speichelleckender Untergebener im grauen Einheitsflanell, als Frauenbeherrscher doch ein Betrogener und Kastrierter, als Angehöriger einer Wohlstandsgesellschaft wird einem Luxus, Erholung, Urlaub und Sinnesgenuss versprochen, um den man aus scheinbar kontingenten und doch als strukturell geahnten Gründen ständig betrogen wird. Soziale und ökonomische Differenzierung zwingt einem auf noch perfidere Weise als der Gehorsam gesellschaftliche Rollen auf. Kurz: die Waren versprechen und halten nicht, die Gesellschaftsordnung und ihre Ideologie versprechen und ermöglichen, verlangen dafür aber Unterwerfung und Verstellung, und die Nächsten, die Frau und die Kinder verlangen, aber man kann ihnen auch nur etwas versprechen – man kann sie mithin nur so behandeln wie man selbst behandelt wird. Dafür macht man Schulden, also weitere Versprechen, die man womöglich nicht halten können wird.
Das ist die Konstellation, in der der Rock’n’Roll geboren wird – und mit ihm und parallel zu ihm natürlich diverse weitere Authentizitätsdiskurse: Männerrebellionsfilme wie “On the Waterfront” oder “The Wild One”, “Angry Young Men” und “Kitchen Sink Drama” in Großbritannien, im weiteren Sinne gehören natürlich auf der Seite der Avantgarden auch die Anfänge von Fluxus, Happening und Performance Art dazu; denn auch dort wird an der vorherrschenden Kunst das Folgen von Rollen und Regeln kritisiert. Die späten 50er und frühen 60er sind sich darin in all ihren emergenten künstlerischen und kulturellen Praktiken darüber einig, dass es zu viel formale Unterscheidungen, Trennungen, Rollen und Vorschriften gibt, die die Menschen, so sagen sie, und meinen vor allem Männer, daran hindern frei zu sein.
Normalerweise würde man einen solchen Befreiungsdiskurs fragen, was er denn vorschlägt, was nach der Befreiung von den Regeln und Rollen das gesellschaftliche Leben regeln soll, aber in diesem Fall war die Frage in der Tat überflüssig: Vor allem wollte der kleine Mann einfach nur so leben wie der große. Er wollte, dass die Versprechen von Warenkultur und Politik eingehalten werden, aber er wollte keine anderen Versprechen, er wollte keine anderen Werte als Grundlage künftiger Versprechen und künftiger Wirklichkeiten. Darum bekämpfen die Erzählungen der 50er und frühen 60er eben immer die Doppelmoral. Der Bürger, der ins Bordell geht, und zuhause den Kindern moralische Predigten hält. Der Vorwurf der Doppelmoral ist aber zunächst nur der, dass sich jemand oder eine Gesellschaft nicht an ihre eigenen Regeln hält, nur selten folgt daraus, dass die Werte, auf denen die Regeln basieren falsch sind – das Bordell etwa oder auch dessen Ablehnung. Und selbst dort, wo das so ist, bleibt immer noch die Frage, ob diese Kritik nur pragmatisch daran Anstoß nimmt, dass eine Regel nicht zu leben ist – wie die Kritik am Zölibat – oder ob sie fundamentaler die Werte angreift, die den Regeln zugrunde liegen und ihnen eine falsche Idee von dem, was Menschen tun und wie sie leben sollen vorwirft. Natürlich lobt das Lob der Authentizität im Rock-Diskurs nicht, dass jemand einfach die Versprechen erfüllt bekommt, es lobt nicht den satten Bürger oder den glücklichen Handwerker, der sein eigener Boss ist (außer vielleicht Springsteen), sondern denjenigen der in einem Akt der Befreiung, der oft etwas Exzessives hat, sein Eins-Sein-mit-sich-Selbst erzwingt. Selbst noch der Ich-Erzähler in Lou Reeds “Heroin” setzt sich seinen Schuss, weil er, wie er eindeutig sagt, als Mann nicht frei sein kann. Erst fünf Jahre später entdeckt sein Verfasser, dass es vielleicht interessanter wäre, ein Transformer zu sein als ein Mann: aber schon dieses Mann- Sein muss erzwungen und erkämpft werden in einem heroischen Akt – andernfalls würde zu schnell klar, dass es nur durchsetzen will, was eh schon da ist. Als heroischer Akt aber öffnet sich der Authentizismus auch für andere heroische Akte, er generiert eine Form der Erwzingung und des Erkämpfens, die auch für Transformation und bodenlose Setzung zur Verfügung stehen könnte. Beide entwickeln auch zu einander ein legitimatorisches Verhältnis: Das Neue, das sich aber durch die Akte der Authentizisten setzt, saugt an deren schon erworbener Legitimität. Und der Authentizist, dessen Akt nun denen der Bodenlosigkeit der Behauptung und der Erneuerung ähnelt, gewinnt so Abenteuer- und Transgressionsqualitäten zurück, die seine Akte bereits in den 60ern beginnen zu verlieren.
Das wäre die dritte These: es gibt immer mal ein symbiotisches Verhältnis zwischen authentizistischen und anti-authentizistischen Positionen. Das sind die Momente, wenn sie am interessantesten sind (oder zumindest wirken). Denn schon in den 50er Jahren konnten wir erleben, wie die heroische bürgerliche Erzählung der Revolte gegen die Lebenslüge in der Form des Rock’n’Roll und begleitender Kunstformen verstetigt und verallgemeinert wird: es geht nicht mehr um einen spezifischen Fall, sondern um ein uns alle strukturell betreffendes Nicht-Eins-Sein, das in der sexualisierten Motorradfahrerei des Rock’n’Roll und in den Cross-Country-Drogen-Abenteuern der Beatnik-Nachfolger nun eine dauerhafte Form eines künstlerisch zelebrierten, aber auch von Einzelnen gelebten Mittels gegen die große Unzufriedenheit gefunden hat. Von dieser Unzufriedenheit hat es eher proletarisch raubeinige Versionen gegeben, bäuerliche wie kleinbürgerlich gebildete. Sie alle trugen zu einer multimedialen Form bei – der Pop-Musik –, deren strukturelle Regel verlangt, dass die Performer stets damit spielen, keine Rolle zu spielen, sie selbst zu sein, authentisch zu sein – und das doch nie ganz sind. Durch diese Regel – das wäre die vierte These – erhält die Pop- Musik einen besonders hohen Gebrauchswert außerhalb ihrer künstlerischen Praxis. Denn durch sie lassen sich Rollenkonflikte besonders gut markieren, managen, adressieren, aber eben auch reaktionär als Natur demarkieren.
Sobald es aber diese Formen als künstlerische Disziplinen gab – sei es in der Pop- Musik der sich ebenfalls in dauerhafter Unzufriedenheit einrichtenden Gegenkulturen, sei es in der die Rolle zugunsten der Selbstdarstellung verlassenden Performance Art, sei es in einer Schonungslosigkeit im Umgang mit sich selbst und durch Klarnamen identifizierbaren anderen Personen feiernden Belletristik mit Tagebuch-Charakter – geriet nun die Ideologie der Authentizität in die Krise. Immer mehr Beteiligte begriffen in der notwendig offenen, tendenziell experimentellen, künstlerischen Praxis selbst, dass das authentizistische Programm eigentlich nur längst durchgesetzte Werte in experimentellen Verwirklichungen erarbeitet. Die künstlerische Form, das Experiment, die Ungeklärtheit des Status des Performers zwischen Rolle und Selbst schien aber viel mehr zu ermöglichen: andere Ziele als die Aufhebung einer erzwungen Rolle – zu welchem Selbst denn auch? – und wurde seit den 60er Jahren auch zusehends von anderen Positionen eingesetzt. Sowohl queere und feministische als auch ökologische und antirassistische Ideen und die dazu gehörigen Szenen und Bewegungen wollten nun nicht mehr einfach das männliche, weiße, heterosexuelle Selbst zu seiner jubilierend johlenden Selbstverwirklichung führen, sondern stellten die Kategorien und Werte infrage, die zunächst nur durchgesetzt werden sollten. Auf ihren Einwänden und Interventionen basierte eine zweite Befreiungskultur, die seit Beginn der 70er Jahre sichtbar wurde. Man hat einige dieser Erfolge und Sichtbarkeiten schon mal historisch der Epoche der Postmoderne oder den neuen sozialen Bewegungen zugeordnet. Doch in allen neuen Bewegungen gab es sowohl einen essenzialistischen Flügel (Differenzfeminismus, ökologischer Naturfundamentalismus etc.) wie einen anti-essenzialistischen; nur letzterer ist hier gemeint. Der erstere ist dagegen oft das Ergebnis der je bewegungsspezifischen Zusammenarbeit von Transformist und authentizistischen Durchsetzern im Format des heroischen Akts.
Das Unbehagen an Authentizismus wurde im Pop-Musik-Diskurs zuerst durch die erwähnte Rockism-Debatte in den späten 70ern in Großbritannien handhabbar. Hier standen sich zum ersten Mal die Gegensätze direkt und expressis verbis gegenüber: Hier der authentizistische Blues-Rocker, dessen Publikum die Qualität einer Performance nach dem echt geflossenen Schweiß bemaß, dort der Transformist und Anti-Rockist, der sich freute, wenn Rollen und Stereotype durch frei erfundene Identitäten und neue Formen der Lust und der Sozialität gekontert wurden. Der erste argumentierte im besten Fall vielleicht sogar noch marxistisch: dem Arbeiter wird im Kapitalismus nur weggenommen, was er produziert; nicht sein Produzieren noch das Produkt ist schlecht, nur die Enteignung. Entgegnet wurde ihm aber und nicht zu Unrecht: Die Industriearbeit selbst und ihre nur zum Konsumismus geplanten, vom Tauschwert dominierten Produkte sind der Fehler. Es gibt kein anthropologisches Substrat des Humanen, das wir wiederhaben können wollen, wir müssen uns ganz neu erfinden. Im britischen Kontext stand für die erste Position ein auch in der Rock-Kultur starker Arbeiterbewegungs-Sozialismus zur Verfügung, für die Gegenposition wurde Roland Barthes oder auch italienische und französische Positionen aus dem operaistischen und postoperaistischen Umfeld bemüht, etwa von Bifo Berardi und Felix Guattari, der damals schrieb: “Man muss […] Partei ergreifen. Die molekulare Revolution besteht darin zu sagen: “Gut, wir werden uns in einer völlig künstlichen Art ein Modell vom Mann, von der Frau, von Beziehungen errichten” (Felix Guattari, “Wunsch und Revolution”). Dies wäre dann ein Modell, bei dem nicht eins zu sein, keine Gefahr mehr darstellt, nicht mehr das Symptom der Unterdrückung und Entfremdung, sondern gerade die Chance der Befreiung. Die spezifische Nicht-Authentizitätserfahrung ist der Beginn, an dem das Subjekt autonom wird.
Die Pointe unserer Gegenwart ist natürlich leider die, dass beide Positionen normativ wurden: sie sind nicht mehr künstlerisch vermittelte und entfaltete Strategien, die über die Kunst hinaus weisen, indem sie eröffnen, wie man leben kann, wie man sein Recht bekommt, wie man den Systemimperativen antworten kann, sondern selber Systemimperative geworden, zwischen denen man aber nicht einmal mehr eine Wahl hat, sondern die sich negativ dialektisch in einer üblen Synthese schließen: Erfinde Dich neu und Sei Du selbst, also erfinde Dich haltlos und bodenlos neu und verkörpere das so, also wäre das immer schon Deine Natur gewesen! Oder noch schlimmer: Erfinde Dich nicht einmal haltlos, sondern den herrschenden Marktanforderungen entsprechend neu und benimm Dich so als, ja glaube an die Wahrhaftigkeit, Authentizität und Traditionalität Deiner Erfindung! Identifiziere Dich! Beweise Deine so hergestellte Identität durch Gefühlsausbrüche, Schweiß, Tränen, Sperma! Beide Positionen sind nicht mehr Punkte in einer Auseinandersetzung zwischen zwei Fraktionen der Linken, sondern in ihrer einst politischen Strategizität wurden sie zu idealen Methoden der Selbstzurichtung für die outgesourceten Selbst-Unternehmer.
Hier stellen sich nun zwei Fragen: Gibt es jenseits dieser beiden Strategien, nennen wir die eine männlich-arbeiterbewegt-rock’n’rollig und die andere queerfeministisch- postmodernen, eine dritte oder gar mehrere? Und: was hat das alles mit Kunst bzw. dem Theater zu tun?
Nun, wir sprechen von Ideologie, wenn man eine Handlungsmaxime, ein Lebensziel, einen Imperativ als selbst gewählt empfindet, der in Wirklichkeit ein ausschließlich von den Bedürfnissen der Verwertung ergangener Imperativ ist. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Temporalität von so verstandener Ideologie zu konstruieren: entweder über eine ideale Unschuld des freien Wählens, der dann Gesellschaft und Kapitalismus im Nachhinein solange ihre Befehle als selbst gewählte Wünsche getarnt einflüstern bis man daran glaubt. Die zweite Möglichkeit – und vor der reden wir hier – ist die, bei der der, wie sehr auch immer berechtigte, Widerstand gegen ein Verhältnis, also eine bereits sekundäre, erworben gedachte Haltung, hinterrücks mit dem Inhalt oder der Funktion ausgerüstet wird, den Verhältnissen, gegen die sie entstand, zu dienen. Dass diese Haltung nicht in Zweifel gezogen wird, liegt daran, dass sie als authentisch empfunden wird, weil der sie hegende sie tatsächlich nicht per Manipulation erst erworben hat, sondern immer schon vertreten. Die Macht hat quasi subversiv sich der Position der Machtlosen bedient, um ihnen, ohne dass sie es merken können, ihren Elan gegen sie selbst gewendet, mit genau demselben Judogriff, der seit Menschengdenken als subversive List gepriesen wird: vom Akt des anderen die Kraft nehmen und gegen ihn richten und die eigene Kraft noch oben drauf satteln.
Dies betrifft in letzter Instanz beide Strategien: Die Authentizisten, die das eh schon Ratifizierte durchsetzen wollen, und die Anti-Authentizisten, die sich neu erfinden wollen, werden beide in dieser negativen Dialektik zu ihren eigenen authentischen oder meta-authentischen Feinden gemacht; authentisch in dem, was sie behaupten und das nur den Verwertungsmechanismen dient. Das Gegenmodell zu dieser negativ dialektischen Wendung könnte demnach nur in Skepsis und Ironie bestehen; dem Pflegen kognitiver Dissonanz, einem gezielten Nicht-mit-sich-eins-Sein, das dann eine andere, nicht marktkonforme Authentizität, eine sozusagen gute Authentizität in ihrer Nachdenklichkeit findet. Diese noble Position kann freilich nur einnehmen, wer sie sich – erstens – individuell ökonomisch leisten kann und wer – zweitens – zu einer sozialen Gruppe gehört, die sich auch kollektiv leisten kann, politisch nicht auf Veränderungen zu dringen. Man konnte eine solche Ironie, die langsam in Zynismus überging, während der letzten 20 Jahre überall dort beobachten, wo der Glaube an die Posthistoire, das Vorbeisein von Geschichte aus dem Ende der Systemkonkurrenz abgeleitet wurde, die in der Überzeugung gipfelte: Ökonomisch ist nun alles machbar, politisch ist das Maximum erreicht, die Geschichte vorbei. Es ist diese Position, die in den aktuellen, neuartigen politischen Bewegungen auf der ganzen Welt am heftigsten abgelehnt wird.
Der Nachteil all dieser Positionen und ihrer Beschreibung ist ihre Reduktion auf Strategie; die eigene, wie die der triumphierenden Gegner. Aber Strategie tendiert, wenn man sie als solche betrachtet, getrennt, von den spezifischen und spezifisch Agierenden, immer zur Fatalität. Das Beste, was sie bieten kann, ist ein Sieg. Und wer will schon nur gewinnen? Sie tendiert weiterhin dazu, einen ganz bestimmten, so aber gar nicht mehr geführten oder führbaren Kampf vorauszusetzen, um so still und implizit die mangelnde Konkretheit des Bewertens von Strategien auszugleichen. Welches aber ist dieser Kampf? Und sind nicht alle Typen von Strategien, die ich hier in ihrer Fatalität vorgestellt habe, auch im positiven Kontexten denkbar, sogar der Kampf für die Verwirklichung dessen, das auf der Ebene der Werte längst Durchgesetzte?
Es ist also wahrscheinlich etwas Anderes, Konkreteres, wenn gerade das Urteil der Authentizität und seine Umsetzung in bestimmte ästhetische Valeurs so ungut mit den Systemimperativen postfordistischer Arbeit korrespondiert, als allein, eine Eigenschaft einer einst emanzipativen, nun ko-optierten Strategie zu sein. Und dieses Andere, Konkretere suchen wir mal in der Kunst: Es gibt die seit 50 Jahren zu beobachtende Neigung, Intensität und Authentizität und andere erstrebte Eigenschaften von Kunst, nicht an der Vergegenwärtigung intensiver Momente selbst, sondern an äußeren Anzeichen, an Indizes der Intensität festzumachen und Intensität und Authentizität danach zu bemessen – unabhängig davon, ob der intensive Vorgang, die Erfahrung das Ziel hatte, man selbst oder ein anderer zu werden, unabhängig davon, ob es um Wahrsprechen oder Glossolalie ging: Als Vorbild für diesen Kultus des Schweißes und der Lautstärke, des Bluts und der Scham kann tatsächlich die Pornographie gelten, die die Echtheit ihrer Darbietung durch die Ausstellung von Körperflüssigkeiten bestätigt.
Diese Anwendung einer juridischen Beweisaufnahme, einer objektiven Bestätigung des im Ästhetischen eben wegen seiner intrinsischen Konstruktion prinzipiell nicht beweisbaren Angemessenheit, Intensität oder Gelungenheit, ist nicht nur die Wurzel einer fragwürdigen ästhetischen Strategie, sondern auch die Wurzel ihres Strategisch-Werdens, also des Strategisch-Werdens eines ursprünglich unstrategisch ästhetischen Handelns und damit seines Zurichtens zu möglichen Imperativen unterworfenen Handelns und marktgeleiteter Selbstoptimierungsideen in der außerästhetischen Welt. Ich möchte also zum Schluss noch einmal nachschauen, was eigentlich in Theater, Performance Art und Pop-Musik, die mir hier die entscheidenden Parameter geliefert zu haben scheinen, falsch oder auch richtig gelaufen ist.
Dies hat sicher mit der Korrespondenz der jeweiligen Formate zu je zeitgenössischen Formatierungen im Alltagsleben zu tun: wie verhielt sich ein Darstellungsweise zu einer des Alltags. Es ist nicht trivial, dass das Spielen einer Rolle, das Anlegen einer Maske – der primäre anti-authentische Akt des Theaters – ja auch dezidiert einen Bruch mit dem Alltag und seinen Normen darstellt, zumindest in dem Maße, in dem dieser Alltag von persönlicher Verantwortung gekennzeichnet ist. Ja, man könnte sagen, dass gerade dort, wo Gesellschaften personale Identität und Verantwortlichkeit entdecken, ja sogar erkämpfen, die Möglichkeit der Tarnung, Verstellung als Komplement und Grenze dieser Regel besonders intensiv vom Theater bespielt worden ist. In der persönlichen Verantwortung liegt ja auch der Hund des Machtverhältnisses begraben, das hinter den hier erörterten Konstellationen steht.
Doch gehört zur Einladung zum Bruch mit der alltäglichen Verantwortung durch triviale Selbst-Identität, die das Theater ausspricht, auf der anderen Seite die Forderung nach Angemessenheit gegenüber der Rolle, also wieder eine Form der Authentizität. Die in zahllosen Reformbewegungen oft gerade gegen ein konventionell erstarrtes Theater erhobene Forderung nach Verschmelzung, Verkörperung etc., die Bewunderung des Strapazen auf sich nehmenden, sich einen Bauch anfressenden, recherchierenden Actor’s-Studio-Schauspielers sind alles Formen dieser Dialektik; zumal ja auch dem Artifiziellen eher aufgeschlossene Schauspiel- Stile durchaus auch mit Angemessenheits-Idealen arbeiten.
Diese Dialektik aber, vor allem je weiter entwickelt und durch Reformbewegungen verfeinert sie im Theater der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts erscheint, passt natürlich als Form ideal auf die Selbstbeschreibungen von modernen Befehlsempfängern im ausdifferenzierten, hochfordistischen Kapitalismus der zweiten Jahrhunderthälfte – vor seinem Übergang in den immateriellen Informationskapitalismus mit seiner forcierten Ausbeutung von überidentifizierten, sich selbst befehligenden Kreativ- und Service-Arbeitern. Vor dieser Phase, als die stabile Unterscheidung zwischen Selbst und Rolle im Alltag zwar schon gesellschaftlich ins Rutschen kam, aber noch der allgemein gültige Name für das Leiden an der Rolle war, unser aller Selbstbeschreibung für Entfremdung, bot das Theater einen virtuose Spiegel für den Stand der Dinge; zugleich schien es aber festzuschreiben, was doch nicht mehr fest zu halten war; nämlich, dass das Problem nur darin bestehe, dass “wir alle Theater spielen”, wie es der Soziologe Irving Goffman benannte.
Nun kann man von den Reformbewegungen eines Avantgarde-Theaters, sei es eines, das Brechtisch die Rolle-Selbst-Differenz politisieren wollte oder das Artaud’sch sie zur Intensität überschreiten, sprechen, oder, noch entscheidender, von einer Performance-Art, die in der Kunst das gesellschaftliche Elend der Rolle überwinden wollte. Aber wichtiger erscheint mir als formale Antwort das performative Konstruktionsprinzip der Pop-Musik zu sein, das ganz mit diesem Gegensatz gebrochen hat. Ich erwähnte es schon: Zur Pop-Musik gehört die Grundregel, dass der Performer oder Singer/Songwriter von sich selbst zu sprechen scheint aber dies zugleich in einem Rahmen von Potenzialitäten tut, die nur endlich viele und erwartbar bestimmte Sätze, Gesten und Inhalte zulassen. Er selbst ist eine Rolle, die er immer wieder spielt, könnte man sagen, aber diese Rolle ändert sich sozusagen authentisch durch sein tatsächliches Schicksal. Es ist eine Rolle, die das Leben schreibt, in Kooperation mit dem selbstzuständigen Autor, der Musikindustrie und anderen Instanzen. Es ist daher konstitutiv unklar, ob der Pop- Musik-Performer eine Rolle spielt oder nicht. Es ist nur eines klar: es ist nie nur eine Rolle und es ist nie nur das Selbst.
Anders jedoch als die Rolle im Theater ist diese Konvention der Pop-Musik unausgesprochen. Es ist nicht die uns allen angepriesene Main-Attraction der Pop- Musik, dass sie von diesem Rollenverhältnis handelt, statt dessen hat sich in ihrem Schatten das triviale Bedürfnis entwickelt, in der Authentizität das zentrale Qualitätskriterium der Pop-Musik zu sehen, also in dem trivialen, mit gutem Grund nie erreichbaren einem Pol des bipolaren Verhältnisses. Gegen dieses hat sich das andere entwickelt, von dem ich gesprochen habe. Beiden ist gemeinsam, dass sie – da nur in Ausnahmefällen und wenn dann nur bei der Gegenbewegung benannt und reflektiert – einen gesellschaftlichen Entfremdungs- oder Identifikationsimperativ kompensieren und kontern, ohne dass sie dies künstlerisch von sich wissen. Der Vorteil wie der Nachteil der Pop-Musik und der vielen, seitdem ihr spezifisches Performance-Konstrukt imitierenden Formate von neuen Theaterformen bis Reality TV und Casting-Show ist, dass die Protagonisten wie aus dem Leben in ihre Formate hineinspazieren. Sie kann daher sowohl einen Brecht noch einen Artaud nur unter bestimmten späten Bedingungen ihrer Entwicklung hervorbringen. Ihr Paradigma ist aber das maßgebliche, nicht nur für viele neue Theaterformen, sondern vor allem für alle möglichen Formate der Bildenden Kunst und des Fernsehens, nämlich jene, die mit Statisten, Partizipation, Wettbewerb und bestimmten wiederkehrenden, mit sich selbst identischen Darsteller-Regisseuren arbeiten.
An dieser Stelle liegt in einem stärkeren Maße das Problem: All diese erfolgreich einen Zwischenbereich zwischen Leben und Kunst bespielenden Formate bereiten Techniken des Selbst vor, üben Lebensalltagsbewältigungen ein, bringen Typen und Haltungen hervor, die natürlich die Imperative des Arbeitsalltags ausstatten und stützen und dabei den Wert der Authentizität als eine unmittelbar aus dieser Kunstform stammende Norm übernehmen; die man nur deswegen übernehmen kann, weil schon in der Rezeption der Pop-Musik nicht verstanden wurde, dass dieses nur eine Seite ist, freilich die schließende.
Es ist aber nicht allein dieser spezifische normative Inhalt der Authentizismus- Norm, sondern darüber hinaus die unmittelbare Übertragbarkeit dieser und auch der entgegengesetzten Norm, die unser Problem ausmacht. Dies ist dem Ausbleiben einer Grenze, einer Unterscheidung zwischen Kunst und Leben geschuldet, die von beiden Seiten – der einst dadurch brisant gewordenen Kunst der Pop-Musik-Tradition und dem zunehmend kreative Ressourcen ausbeutenden (Arbeits-)Leben –, die Handlungen mit einem Alltagsnutzen und Realitätsgrad ausstattet, der uns in eine zirkuläre Authentizismus-Falle jagt. Die in der schon zu Beginn beschriebenen Symbiose zwischen authentizistischen und anti- authentizistischen Akten angelegte Problematik liegt in einem viel stärkeren Maße nicht in den künstlerischen Nähen und dem performativen Auf-einander- Angewiesen-Sein, sondern in dem hohen Gebrauchswert, den die Performance- Kultur der Pop-Musik hervorgebracht hat, in der Unmarkiertheit ihrer virtuosen Produktion von Handlungs- und Haltungsangeboten, die alle ja auch zu Befreiungszwecken nützlich waren: Gerade weil die Pop-Musik die erzdemokratischen und revolutionären Tugenden des Durchsetzens und Neuerfindens von Lebensmöglichkeiten so gut beherrschte, so gut steuerbar machte, ist sie so ideal für Produktionsmodelle im Bio-Kapitalismus; gelingt es ihr so famos Selbsterfindung und Selbstidentität zu Normen und Imperativen werden zu lassen. Das wäre die fünfte und vorletzte These.
Undialektisch wäre es, daraus den Schluss zu ziehen, man müsse verlangen, von all dem zu lassen, müsse sich posthistorisch zurückzuziehen aus der Produktion, Anwendung von Haltungen und Handlungsmöglichkeit, Modellen von Selbst- und Fremdverhältnissen – da diese ja eh nur falsch in der Wirklichkeit landen. Undialektisch wäre es auch, dem Theater zu verordnen, es müsse sich nur einfach re-artifizialisieren – auch wenn so etwas punktuell vielversprechend ist. Die Fähigkeit der darstellenden Künste, die hier skizzierten Komplexe anschaulich zu machen, zur Sprache zu bringen, zu relativieren und zu verflüssigen, muss sich auf das Niveau der Debatten bringen und direkt in die künstlerische Arbeit eingehen – nicht um die Haltungen zu verbessern, sondern um die Macht ihrer Unmarkiertheit zu brechen. Denn wo immer Kunst und Leben, Kunst und Politik, Theaterwelt und Lebenswelt konvergieren, ohne über die Modi ihrer Verbindung, ihrer Transgression in die Territorien der je anderen Seite selber zu reden oder diese zu gestalten, überall dort, wo Kunst glaubt unumwunden keine Kunst mehr sein zu können, produziert sie reine Strategie. Und die greift sich im Zweifelsfall immer die Macht. Das war die sechste These und der Schluss.
Published 18 December 2012
Original in German
First published by Polar 13 (2012) (German version)
Contributed by Polar © Diedrich Diederichsen / Polar / Eurozine
PDF/PRINTSubscribe to know what’s worth thinking about.
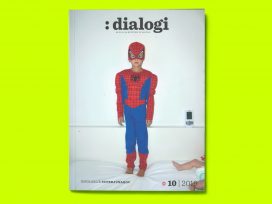
Dialogi analyses superhero narratives East and West: from Slovene romanticism to post-communist spoof and the neo-con blockbuster.

Concerned to avert a ‘singing revolution’ in Russia, the Kremlin has co-opted the country’s independent music scene. Apolitical and nihilistic, it is doubtful whether Russian artists could ever play the same role as their Ukrainian counterparts on the Maidan. The group Shortparis is a notable exception – for now.