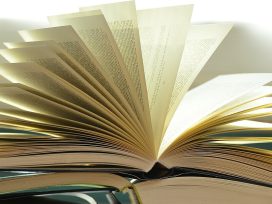(…) was die anderen vernichtet, erhebt mich immer mehr, begeistert und stärkt mich (…)
ProudhonOhne eine Dosis “Fatalismus” wäre das Leben eines Revolutionärs überhaupt unmöglich.
Trotzki
In einer eindringlichen Diskussion zwischen Franz Schuh und Doron Rabinovici bei der Sommerschule der Waldviertel-Akademie im Sommer 2004 – es gibt solche Sternstunden gemeinsamen Diskutierens – ging es um die Frage, ob es eine spezifisch religiöse Gewalt gebe. Während Schuh dies mit Seitenblick auf Canetti eher in Abrede stellte, wies Rabinovici darauf hin, dass Religionen über ein historisches Wissen um den Tod verfügen. Sie verstehen, wie Rabinovici es formulierte, etwas vom Tod. Religion ist, so könnte man sagen, jenes kulturelle Phänomen, das nicht nur dem Leben, sondern vor allem dem Tod (und über diesen Umweg auch dem Leben) “Sinn” verleiht.
Wie steht es nun demgegenüber um das Verhältnis “der Linken” zum Tod (und damit auch zu Phänomenen wie Opfer und Gewalt), jener politisch-intellektuellen Formation, die im Gefolge der Französischen Revolution entstand und über ein Jahrhundert auf die eine oder andere Weise mit der Doktrin des Marxismus verquickt gewesen ist? Als Teil der Aufklärung und der in ihr angelegten Religionskritik zielt sie auf eine Negation des Todes, zumindest aber auf eine Ablehnung all jener symbolischen Konstruktionen, die den Kräften des Negativen – Leid, Schmerz und Tod – Sinn verleihen, den Religionen. Von Bazon Brock, einem klassischen avantgardistischen Modernisten, ist der Ausspruch verbürgt, der Tod sei ein “Skandal, gegen den man protestieren muss”1. Für den linksexistenzialistischen, dem Marxismus gegenüber kritisch eingestellten Humanisten Jean Améry ist der frei gewählte Ausstieg aus dem Leben hingegen eine individuell heroische Tat, in der sich die Freiheit des Menschen manifestiert: “Ich bin es, der Hand an sich legt, der da stirbt, nach Einnahme der Barbiturate, ‘von der Hand in den Mund'”.2 Frei-Tod. Der Tod der Moderne unterscheidet sich prinzipiell vom Tod in allen religiösen Traditionen, und die linke Wahrnehmung des Todes war über lange Zeit ein integraler, unverzichtbarer Bestandteil moderner Befindlichkeit.
Freilich hat die “klassische”, marxistisch imprägnierte Linke – unentbehrliche Proponentin jenes Projekts einer radikal verstandenen Aufklärung – Teil an der unfreiwilligen Umkehrung, die seit Horkheimers und Adornos berühmtem Buch als Dialektik der Aufklärung bezeichnet wird. Insofern der aus der marxschen Theorie auskristallisierte Marxismus ungeachtet seiner programmatischen Religionsfeindlichkeit sich zu einer wirkungsmächtigen, eschatologischen Weltanschauung entwickelte, wie sie Jacob Taubes, Eric Voegelin und Karl Löwith mit gänzlich unterschiedlichen Wertungen analysiert haben, reproduzierte er mythische und religiöse Strukturen und Kategorien. Soweit er sich als eine politische Religion mit eschatologischem Charakter bestimmen lässt, verleiht er, übrigens ganz ähnlich wie die “Industriereligion” (Gellner) des Nationalismus, dem Tod, insbesondere dem heroischen, einen höheren Sinn: Gestorben wird und wurde nicht umsonst, sondern für eine höhere Sache – die Nation, das Volk, die klassenlose Gesellschaft, das Dritte Reich. Es mag waghalsig erscheinen, aber es lässt sich füglich behaupten, dass der deutsche Nationalsozialismus in der Tat die verdeckten und pervertierten religiösen Energien des Sozialismus wie des Nationalismus, die sich wechselseitig aufluden, in geballter Form in sich aufnahm. Das macht die deutsche Situation historisch einmalig. Lange vor Celan hat der germanophobe, hellsichtige französische Politiker Clemenceau sinngemäß davon gesprochen, dass der Tod ein Meister in Deutschland sei. Das hat eine Geschichte des linken Todes in Rechnung zu stellen.
Was verstehen “politische Religionen” (Voegelin)3, Religionen nach dem Tod Gottes, vom Tod? In seinem ungeheuer komplexen Stück Dantons Tod hat Büchner die zwei Gesichter des linken Todes beschrieben: Es geht dabei um Dantons Tod wie um den seines Widersachers. Beide zusammen, Danton und sein Antagonist Robespierre, verkörpern die heterogene Einheit des linken Todes. Bekanntlich hat Marx die Verkleidung der bürgerlichen Revolutionäre, die in die Gewänder der antiken Demokratie schlüpften, mit Spott bedacht.4 Sozialisten und Kommunisten wiederholten diese historische Maskerade, nur entliehen sie ihre Kostüme der Französischen Revolution. Es war gerade die radikale kommunistische Linke, die sich – ungeachtet der sozialen Differenz zur bürgerlichen Revolution – in den Auseinandersetzungen und Fraktionierungen der Französischen Revolution gespiegelt sah und sich mit den Jakobinern identifizierte. Vom revolutionären Impetus her besehen ist dies plausibel, und Büchners Stück lässt sich deshalb heute auch als Kommentar zum Kampf der beiden Linien im Marxismus lesen. Die Kontroverse zwischen Danton und Robespierre gipfelt in der Frage der Revolution, und das meint in ihrer messerscharfen Logik: im Problem des Todes. Man sollte Büchners Stück zusammen mit Brechts Maßnahme und Heiner Müllers Mauser in einem Atemzug lesen.
Der Titel des Stückes ist infolge der Semantik des Genetivs zweideutig. Dass ihn am Ende der Tod ereilt, dass die Revolution ihre Kinder frisst, ist die eine bekannte, bittere, “objektive” Bedeutung, aber dass das Stück auch deshalb Dantons Tod heißt, weil es dessen Haltung zu Leben und Tod thematisiert, wie er sie als Subjekt formuliert, wird dem Zuschauer gleich im ersten Auftritt gewärtig. Büchner spitzt den Konflikt zwischen Robespierre und Danton gleichsam archetypisch zu und führt uns die ungleichen Hälften jener Konfigurationen vor, die später die Linke heißen wird. Nicht so sehr die Differenz des politischen Programms, die die beiden Protagonisten trennt, bildet den Brennpunkt des dramatischen Geschehens. Es geht vielmehr um ein antagonistisches Verhältnis zur Revolution. Dass die Revolution aufhören muss, wie der feinsinnige Zyniker und Aphoristiker Hérault de Séchelles verkündet, impliziert nicht nur eine politische Position der Mäßigung, sondern stellt zugleich philosophisch die Revolution in Frage, die in ihrem heroischen Pathos dem Töten eine Lizenz gibt, ja, dieses sogar zwangsläufig macht und zur revolutionären Pflicht erhebt. Jede politische Abweichung wird im Verlauf der sich radikalisierenden Revolution zum Ausgangspunkt eines Kampfes auf Leben und Tod. Wenn sich also Danton und seine Freunde am Spieltisch und im Gespräch mit attraktiven Grisetten amüsieren, dann bedeutet dieser intentionale und programmatische Verrat an der Revolution einen doppelten Einspruch: gegen den lebensfeindlichen asketischen Heroismus der Revolution, die systemlogisch den Tod einfordert, die Bereitschaft zum Töten der jeweilig aufs Neue auftretenden Widersacher und den heroischen Willen, das eigene Leben zu opfern. (Nach 1968, im marxistischen “Neolithikum” (Franz Schuh), war es im erbitterten Kampf der gauchistischen Fraktionen durchaus möglich, dass die maoistische Fraktion ihren trotzkistischen Widersachern einen Eispickel vor die Tür legte, um sie an das Schicksal ihres Heroen zu gemahnen). Dantons milder Zynismus entspricht aber auch einem existenziellen Protest gegen den Tod. Es ist die kurz bemessene Frist des Lebens, die die Unersättlichkeit des Begehrens auf den Plan ruft.
Es gilt, wie Brecht später formulieren wird, das Leben zu schlürfen, bevor man es lassen muss. Genuss als Habgier der Lust und als Triumph der Gegenwart erscheint als die einzige Antwort auf das Damoklesschwert eines hier durch und durch sinnlosen Todes. Jeder glückliche Fick und jedes Gelage werden zu einem so sinnlosen wie kurzen lustvollen Einspruch gegen die Macht des Todes, der gerade die Revolution in ihrer unbarmherzigen Eigenlogik wieder zum Durchbruch verhilft. Mit dieser Haltung repräsentieren Danton und seine Freunde den Typ des vorrevolutionären Aufklärers, für den die Welt nach dem Tod Gottes endlich in der Zeit geworden ist. Aber zugleich ist es der logische Schluss des Revolutionärs, der die Revolution durchlaufen und ihre Tiefenstruktur durchschaut hat, dem vor ihr ekelt und der ungläubig – “post-histoire” – verkündet, dass “der göttliche Epikur und die Venus mit dem schönen Hintern zu Türstehern der Republik werden” sollen.5 Diese prinzipielle Situation des Seins zum Tode ist in Büchners Stück durch die revolutionäre Situation dramatisch zugespitzt: In ihr schrumpft die Frist womöglich auf sechzig Minuten zusammen.
Ganz anders stellt sich die Situation für jene dar, die der Revolution “treu” geblieben sind, für Linke vom Typus des Robespierre. Indem sie die Revolution vollstrecken, erweisen sie sich als Todesengel der Geschichte; sie tun dies im Bewusstsein, dass der Tod nicht sinnlos ist: Er ist Teil eben jener säkular gewordenen Heilsgeschichte, in der das Leben des Einzelnen in einem größeren Ganzen, der Geschichte, dem Fortschritt, der Menschheit aufgehoben ist: aufgehoben in einem dreifachen Sinn – bewahrt, beseitigt, eingebettet. Das Einverständnis mit dem Schrecklichen ist es, das den Revolutionär zum Helden macht, der das Leben gering achtet, das eigene wie das fremde. Weil die Revolution dem Töten eine Lizenz erteilt, bedeutet das schiere spontane Mitleid einen erbärmlichen Verrat. Insofern führen die Russische Revolution und ihr Terror, die Koestler und Merleau-Ponty so kontrovers kommentiert haben, jenseits der Maskerade die Wiederkehr jener Logik des modernen Opfers wieder ein, die zum ersten Mal in aller Grellheit in der Französischen Revolution hervorgetreten ist. Die Geringschätzung der Sozialdemokraten seitens der bolschewistischen Revolutionäre, wie sie in Lenins Polemiken manifest wird, hat, von allen konkreten taktischen und strategischen Divergenzen einmal abgesehen, ihre tiefere Ursache darin, dass die sozialdemokratischen Reformer nicht aufs Ganze gehen, halbherzig sind, nicht ihr und anderer Leben aufs Spiel setzen mögen. Aus dem Blickwinkel einer heroisch-revolutionären Linken gilt dies als verächtlich und spießig. Vor allem als bürgerlich: Denn nur der Bürger lebt (angeblich) in der Angst, etwas zu verlieren. Was der “versöhnlerischen” Sozialdemokratie aus dieser Perspektive fehlt, ist eben jener Akt von Selbstsetzung, die nur durch die Gewalt, durch die Auslieferung an den Tod möglich ist. Die Verachtung des langweiligen Friedens haben bei allen weltanschaulichen Differenzen die radikale Rechte und die radikale Linke strukturell gemeinsam, wobei die linke Unversöhnlichkeit rhetorisch noch viel stärker zu Buche schlägt, wie das Kompendium des Stalinismus, die im Namen Josef W. Stalins erschienene Geschichte der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (Bolschewki) es unmissverständlich ausspricht: “Die Geschichte der Partei lehrt weiter, daß die Partei der Arbeiterklasse ohne unversöhnlichen Kampf gegen die Opportunisten in ihren Reihen, ohne Vernichtung der Kapitulanten in ihrer eigenen Mitte die Einheit und Disziplin ihrer Reihen nicht aufrechterhalten, ihre Rolle als Organisator und Führer der proletarischen Revolution, ihre Rolle als Erbauer einer neuen, der sozialistischen Gesellschaft nicht erfüllen kann.”6
In Hegels berühmter Formel von der List der Vernunft schwingt dieses, der französischen terreur entsprungene, ins Zynische gewendete Einverständnis mit der unerbittlichen Gewalttätigkeit der Geschichte mit, die kein Erbarmen mit dem Einzelnen kennt; dieses, die eigene Position konstituierende Credo, das bei Robespierre und bei Stalin und seinen Schergen so schwülstig daherkommt. Die großen Epochen der Geschichte verdienen ihren Namen nur, weil sie so viele Opfer mit sich bringen. Die Geschichte ist gleichgültig gegenüber dem Glück des Einzelnen. Hegels Verkündigung des Endes der Geschichte lässt sich nur vor dem Hintergrund der heroischen Erfahrung der Französischen Revolution und Napoleons verstehen. Der Zynismus ist beim deutschen Meisterdenker dialektisch gemildert: Das Schlimmste und Furchtbarste, so die narrative Logik bei Hegel, liegt bereits hinter uns. Das große Opfer, die Katakomben von Toten in den Napoleonischen Kriegen, ist heilsgeschichtlich besehen schon vollbracht. Das Glück des Einzelnen darf sich bescheiden zu Wort melden, eben weil die Geschichte ihr Ziel erreicht hat. Für Hegel wie später für Carlyle war Napoleon der letzte Held. Für Hegel bleibt fortan die bürgerliche Langeweile des preußischen Beamtenstaates.
Danton und Robespierre verkörpern zwei Reinformen eines linken, postreligiösen Umgangs mit dem Tod: zynischer “savoir vivre” auf der einen, heroischer Nihilismus auf der anderen Seite. Wenn wir die heroischen und nicht-heroischen toten Linken – die Schreibtischtäter sind die realen Akteure der Revolution – betrachten, so sind die Mischungen am interessantesten. Nehmen wir zwei deutsche Schriftsteller, die in einem eigentümlichen Nachfolgeverhältnis zueinander stehen: Bertolt Brecht und Heiner Müller. Brecht, der Ultrabolschewist, der das terroristische Stück Maßnahme schreibt, das heute nur mehr dekonstruktivistisch aufführbar ist, und der zugleich das Antiheldentum Galileis pardoniert, Brecht, der beinahe zeitlebens, die mageren Jahre des Exils ausgenommen, einem großbürgerlich-bohèmehaften Lebensstil frönt, wie ihn Danton und seine Freunde bei Büchner kultivieren, schreibt kommunistische Lehrstücke, in der die Logik von Opfer und Askese im Zentrum steht. So viele undialektische Widersprüche.
In Heiner Müllers uvre spielt der Tod eigentlich die Hauptrolle. Dieser merk- und denkwürdige Nachfolger Brechts, ein moderner Ersatzklassiker und “schwacher”, das heißt epigonaler Dichter im Sinne Harold Blooms, hat, bei allen Absetzversuchen, diese zwei Seiten des linken Todes noch einmal reproduziert. Sein Stück Mauser wiederholt den heroischen Gestus jenes Kampfes auf Biegen und Brecht, in dem die Revolution zum selbstläufigen Massaker wird: Der für die Revolution tötet, wird selbst zu ihrem logischen Opfer. Wer für die Revolution Gewalt anwendet, stirbt für und durch sie, und zwar exakt zu dem Zeitpunkt, als er mit dem Töten aufhören möchte.7 Müller, der unheroische Lebemann, löst diese Spannung im Stück nicht auf. Darauf beruht dessen dramatische Wirksamkeit. Wer nicht mehr töten will, der verliert das Privileg, ein herausgehobenes Subjekt, die Hauptfigur der großen Erzählung namens Revolution zu sein. Sofern die Revolution, die einen nur vor die Alternative zu töten oder selbst zu sterben stellt, historisch im Recht ist, geht das Todesurteil, das sie ausspricht, moralisch in Ordnung. Die Pointe der revolutionären Ethik und Moral ist nicht, dass sie – wenigstens neutral besehen – keine wäre, sondern dass sie eine Moral der tödlichen Ausnahmesituation ist, in der fast alles erlaubt zu sein scheint, in der aber das Töten zum kategorischen Imperativ wird. Wir sollten uns abgewöhnen, Moral und Ethik per se als etwas Gutes oder Schlechtes (was nur die Umkehrung der normativen Besessenheit ist) anzusehen, sondern lernen, gute und schlechte, angemessene und unangemessene Ethiken zu unterscheiden.
Jede Zeit hat ihre eigene Moral, wie Merleau-Ponty in seinem prekärsten Buch Humanismus und Terror schreibt: “Durchlebt man, was Péguy eine geschichtliche Periode nannte, und beschränkt sich als politischer Mensch darauf, ein bestehendes Regime oder Recht zu verwalten, so darf man auf eine gewaltlose Geschichte hoffen. Hat man dagegen das Pech oder das Glück, eine Epoche zu durchleben, einen jener Augenblicke, wo der traditionelle Boden einer Nation oder einer Gesellschaft zusammenbricht und wo der Mensch, ob gern oder ungern, selber die menschlichen Beziehungen wieder aufbauen muß, dann bedroht die Freiheit jedes Einzelnen die der Anderen mit dem Tod, und die Gewalt tritt wieder in Erscheinung.”8 Merleau-Ponty geriert sich wie Hegel als unbeteiligter Beobachter und Erzähler. Jede revolutionäre Leidenschaft scheint ihm in der distanzierten und gleichmütigen Rolle dessen, der sich der Geschichte einfach unterwirft, fremd. Die einzige Frage bleibt für ihn, ob die revolutionäre Gewalt des Kommunismus noch immer seinen humanistischen Absichten dient, wie sie den großen Erzählungen seit der Aufklärung inhärent sind.
Der schon erwähnte Trotzki vereinigt Danton und Robespierre auf grandiose Weise in einer Person. Während Lenin unter der Schönheit von Beethovens Musik angesichts der sozialen Unterdrückung und Ausbeutung des Proletariats litt, war Trotzki ein Mensch, der schöne Frauen, feine Kaffeehäuser, moderne Kunst und Literatur schätzte und sich für eben jene Psychoanalyse interessierte, die der klassische marxistische Revolutionarismus nicht grundlos verabscheute und fürchtete, weil er ihr psychologisch und lebensphilosophisch die Grundlage entzog. Aber zum anderen war Trotzki ein Maximalist des Terrors, nicht nur als Befehlshaber der Roten Armee und nicht nur wegen seiner Verantwortung für die blutige Niederschlagung des Kronstädter Matrosenaufstandes, sondern wegen seiner an Marx anschließenden geschichtsphilosophischen Option für die permanente Revolution, die als Formel nicht wenige in den Bann schlug und neben seinem linken Märtyrertod mit dazu beitrug, dass Trotzki neben Rosa Luxemburg und Che zum berühmtesten toten Linken avancierte. Was ihn von allen anderen Widersachern Stalins unterscheidet, ist, dass sein Denken – sein Denken, nicht seine Taten – revolutionärer und terroristischer war als jenes Stalins. Stalin will angesichts der fatalen weltgeschichtlichen Lage und als Resultat der in Europa gescheiterten sozialistischen Revolution diese blutig beenden und einen Sozialismus im eigenen Land etablieren, weshalb ihn Trotzki höchst halbwahr mit Napoleon vergleicht. Trotzki ist der Heroe, der die Revolution weltweit weiterführen will. Mehr noch: Die Revolution, der Ausnahmezustand, der Linke wie Rechte (Carl Schmitt) so beeindruckt hat, soll zum Fundament einer neuen Ordnung werden. Nie wieder darf das, was die Revolution an Freiheit geschaffen hat, institutionell erstarren. Daher auch Trotzkis Sympathie für die künstlerischen Avantgarden seiner Zeit, die das Zertrümmern zum Prinzip erheben.
Die heroische Todessehnsucht und Gewaltbereitschaft des linken Revolutionärs, wie sie Che Guevara vielleicht am reinsten und naivsten verkörpert hat, ist eingebettet in zwei große Erzählungen. Die eine ist eine radikale Version der großen Erzählung des Fortschritts (wie sie Lyotard beschrieben hat), die andere aber jene, die besagt, dass man ein Subjekt im dezidierten Sinn nur durch den Kampf werden kann, durch einen Kampf, der einer auf Leben und Tod ist. Der Kampf ist Mittel und Selbstzweck, Mittel, weil er die Durchsetzung jener großen sozialistischen Ideale ermöglicht, Selbstzweck, weil nur der Kampf, bei dem man/n alles auf eine Karte setzt, groß macht. Das Proletariat spielt noch einmal Hegels Geschichte von Herr und Knecht durch, indem es die dort beschriebene und antizipierte Dialektik geltend macht und sich zum Subjekt erhebt, das heißt zu einem wirkungsmächtigen Subjekt, das, wie es in der “Internationale” heißt, mit Macht zum Durchbruch dringt.
Zur Besonderheit der deutschen Befindlichkeit gehört jener Konnex von einsamer Heroik und Todesnähe, die Clemenceau an der deutschen Kultur des 19. Jahrhunderts aufgefallen war und die Canetti im Bild des soldatischen Waldes aus Shakespeares Macbeth festgehalten hat. In Kleists Werk, das die intellektuelle Linke wie die Rechte in Deutschland maßgeblich beeinflusst hat, ist eine Semiotik eingeschrieben, in der der Tod allgegenwärtig ist. Die Hermannsschlacht oder der Prinz von Homburg sind nur die auffälligsten Beispiele dieses Sachverhalts. Ähnliches lässt sich vom Werk Heiner Müllers (in dem ein Mafiaboss namens Canetti seinen Auftritt bekommt) sagen, der nicht nur ein Wiedergänger Brechts, sondern auch Kleists ist. Einer der spannendsten und bewegendsten Abschnitte in Heiner Müllers Lebensbilanz Krieg ohne Schlacht. Leben in zwei Diktaturen ist jener, in der er seine Begegnung mit Ernst Jünger, den er in seinem herrschaftlich schwäbischen Refugium besucht, schildert. In diesen Seiten spiegelt sich noch einmal die Anziehungskraft, die der rechte Kämpfer auf den Linken ausgeübt hat, Schlageter auf Radek, Carl Schmitt auf Benjamin, Jünger auf Müller. Genauer, der frühe Ernst Jünger zwischen Erstem Weltkrieg und der Machtergreifung Hitlers. Es ist die Unerschrockenheit und Todesverachtung, die Müller spürbar, bei aller politischen Reserve, am Weltkriegssoldaten und “lonesome traveller” bewundert. Müller referiert Jüngers Behauptung, wonach Mut im Krieg eine Frage der Ausbildung, Mut im Bürgerkrieg jedoch etwas Seltenes sei. Und er zitiert einen Aphorismus aus Jüngers früher Essay-Sammlung Blätter und Steine: “In einem Vorgang wie dem der Somme-Schlacht war der Angriff so etwas wie eine Erholung, ein geselliger Akt.” Müller kommentiert beifällig: “Das ist ein Satz, der mir schon damals sehr einleuchtete.” Jünger beschreibe, so Müller, eine “Erfahrung der Materialsschlacht, der man mit Pazifismus nicht beikommt, nicht mit einer moralischen Position”. Aufschlussreich und hellsichtig schließt Müller das Kapitel über den fragilen Jahrhundertzeugen mit dem Satz: “Jüngers Problem ist ein Jahrhundertproblem: Bevor Frauen für ihn eine Erfahrung sein konnten, war es der Krieg.”9 Nichts war so geil wie der Krieg, vor allem angesichts der gründlichen Unkenntnisse der unsoldatischen Gelüste. Das ist ein Satz, der eine ganze feministische Abhandlung über den “machismo” der konservativen und bolschewistischen Revolutionäre (mitsamt ihren Mischungen, Ernst Niekisch oder die Strasser-Brüder) beinahe überflüssig macht und selbst Theweleits Männerphantasien in den Schatten stellt.
Müller zieht indes eine klare Trennungslinie zwischen ästhetischer und politischer Positionierung. Die Gewalttätigkeit und Bösartigkeit werden zum Privileg eines Ästhetischen, in dem sich die heroische Größe des Todes in seinen beiden Aspekten – Tötungsbereitschaft und Todesbereitschaft – sublimierend in einer Nische der Kultur erhält. Seine Theaterstücke versteht Müller durchaus als eine ästhetische Materialschlacht, als eine “Marne-Schlacht”, als bösartigen Ausgriff, als Ersatzhandlung für eine politische Handlung, die nicht mehr möglich ist. Insofern ist Heiner Müller kein zynischer Postmodernist, sondern ein Spätmoderner, der sich noch immer mit den heroischen Überresten linken Bewusstseins herumschlägt.
Michel Foucault, den Müller mehrmals positiv als einen radikalen Denker lobend erwähnt, hat in seinem Essay über den Tod des Autors die heroische Kehrseite zur ästhetischen Tötungswut des linken Modernismus beschrieben. Er unterscheidet nämlich den traditionellen Autor vom modernen durch sein Verhältnis zum Tod. Während der klassische Autor sich und sein Werk durch sein Schreiben unsterblich macht (sich listig dem Tod entzieht, wie die Erzählerin in Tausendundeine Nacht) und so den Tod im und durch das Werk überwindet, fällt der moderne Autor – Foucault bezieht sich hier auf Kafka, es ließe sich aber auch an Thomas Bernhard denken – gerade durch sein Werk dem Tod anheim. Das literarische Werk, das er schreiben muss, ist sein tödliches Schicksal, bereitet ihm, ähnlich wie die Revolution dem Revolutionär, das Grab. Kafkas Heroik besteht in dieser Lesart darin, dass ihn das eigene Werk umbringt.
Diese Konsequenz ist Müller wie schon zuvor Brecht fremd; sie sind Überlebende beinahe im Sinne Canettis, denen – so lautet die Lebensmaxime – nicht das Schicksal des Genossen in der Maßnahme oder in Mauser zuteil werden soll. Während die exemplarische Figur stellvertretend zu Grunde geht, hält sich der Autor am Leben. Das Faible für eine schwarze Ästhetik bei so unterschiedlichen Intellektuellen wie Karl Heinz Bohrer, Rudolf Burger und – sichtbar abgeschwächt – bei Konrad Paul Liessmann hängt aufs Engste mit dem “Symptomschmerz” zusammen, dass die Position der intellektuellen Rechten wie der linken Revolutionäre politisch nicht mehr eingenommen, nur mehr im Spiel der Worte – der Philosophie wie der Dichtung – ausgetragen werden kann. Der Kitsch der bösen Ästhetik ist die uneingestandene Ab- und Aufräumarbeit des von Müller scharfsinnig bezeichneten Jahrhundertproblems. Unter den Bedingungen der Hypermoderne ist sie, wie die Kapriolen des deutschen Regietheaters zeigen, in Gefahr, sich zu einem bloßen Effekt im Kontext einer “Ökonomie der Aufmerksamkeit” (Georg Franck) zu minimieren.
Der Tod der Linken hat zwei Seiten: Im Sinne des “genitivus subjectivus” meint er zwei konträre Arten zu sterben, Verausgabung durch Genuss, Tod auf dem Faul- und Lotterbett, und Verausgabung durch Gewalt, Tod im letzten Gefecht. Mittlerweile ist auch der “genitivus objectivus” zu einem historischen Tatbestand geworden. Denn als historisch-intellektuelle Konfiguration, wie sie die westlichen Gesellschaften (und nicht nur diese) in der Zeit von 1890 bis 1990 prägte, ist das, was einmal unscharf die Linke hieß, unwiderruflich an ihr Ende gekommen. Das muss nicht heißen, dass unter den heutigen Bedingungen in der westlichen Kultur und Gesellschaft keine neuen linken Formationen denkbar wären, aber sie werden ein anderes Gesicht haben, aus dem Todesbereitschaft und Tötungswillen entwichen sind. Man muss schon ein hartgesottener linker Nostalgiker sein, um das Ende der todesbereiten Linken zu bedauern und den einstmals mobilisierenden Slogan “Tod den Feinden der Revolution”, der in Heiner Müllers Mauser-Stück noch einmal zitiert wird, wieder auf die Tagesordnung setzen zu wollen. Der Terrorismus, dieses Manifest des Todes, das zumindest in Deutschland von Linken wie von Rechten zunächst schreibend ausfantasiert worden ist, hat, von Randzonen (Irland, Baskenland) abgesehen, die Kultur des Westens mitsamt den politischen Religionen des 20. Jahrhunderts – Bolschewismus, Anarchismus, Faschismus, Nationalsozialismus – verlassen. Ob nicht im Terrorismus islamischer Provenienz auch ein verschwiegenes modernes, nach-linkes Motiv mitschwingt, das gar nichts mit traditioneller muslimischer Frömmigkeit zu tun hat, sondern sehr viel eher mit heroischen Maßnahmen und nihilistischen Setzungen des Ausnahmezustandes, sei hier wenigstens als Frage formuliert. Ein kurzer Blick auf das gegenwärtige Phänomen des islamischen Terrorismus lässt wie in einem Zerrspiegel das Bild der eigenen Anfälligkeit für den gewaltsamen Tod – und welcher Tod wäre am Ende nicht gewaltsam? – zu Tage treten. Dabei wird sichtbar, dass das linke Faible für die Revolution auch ganz andere Motive in sich barg als den edelmütigen Sinn der Gerechtigkeit: die Sehnsucht nach Außerordentlichkeit, wie sie nur die Epiphanie des Grenzphänomens Tod zu gewähren scheint, zuerst als dessen Vollstrecker, sodann als dessen Opfer. Der heutige Selbstmordattentäter, männlich wie weiblich, fasst beide Aspekte, Gewalt gegen den anderen und Gewalt gegen sich selbst, in einem Akt zusammen. Er/Sie folgt weniger den traditionellen Lehren des Islam, seine/ihre Todesbereitschaft ist vielmehr ein pervertierter Freitod, der die Feinde der islamischen Revolution in den Abgrund zieht. Der Umstand weiblicher Selbstmordattentate unterstreicht den modernen “existenzialistischen” Aspekt dieser Taten. Die Terroristinnen stellen – sarkastisch gesprochen – eine Avantgarde emanzipierter muslimischer Frauen dar. Sie tragen, buchstäblich oder im übertragenen Sinn, keine Burka und keinen Schleier.
In unserer Typologie über die Linke und den Tod wenigstens abschließend erwähnt sei der Typus des linken Melancholikers, wie ihn in unterschiedlicher Weise etwa Walter Benjamin und Cesare Pavese (vermutlich auch Améry) verkörpern. Die etwas verkitschte Märtyrerlegende um Benjamin, die dessen Freitod vornehmlich als Reaktion auf die drohende Gefangennahme durch die Nazis interpretiert, verdeckt das Ausmaß von Verzweiflung und damit eben jene Geschichte, die ich als Tod der Linken bezeichnen möchte, als Akt der Desillusion, die unter den historischen und persönlich elenden Bedingungen eine dramatische Schubumkehr erfuhr. So viele “verdrängte” Niederlagen, so viele Enttäuschungen.
Der Melancholiker ist Freud zufolge das Subjekt, das sein geliebtes Objekt, hier die Revolution, nicht vergessen, das den Tod der Linken nicht verwinden kann und an sich selbst nachvollzieht. Mag uns auch das modernistische Pathos eines Benjamin und die Strenge eines Pavese, dessen Suizid sich auch nicht ausschließlich auf eine tragisch verlaufene Liebesaffäre reduzieren lässt (wie viele, die solche Situationen überleben, zuweilen sogar mit existenziellem Gewinn), einigermaßen fremd geworden sein, so vollzieht der Akt der Selbsttötung den Tod der Linken auf eine historisch fast mustergültige Weise. Am 25. März 1950, fünf Monate vor seinem Freitod, notiert Pavese: “Man bringt sich nicht aus Liebe zu einer Frau um. Man bringt sich um, weil eine Liebe, irgendeine Liebe, uns in unserer Nacktheit, unserem Elend, unserer Wehrlosigkeit enthüllt.”10 Diese Wehrlosigkeit, die sich enthüllt, koinzidiert mit einer intellektuellen Krise, einer Krise des Schreibens und einer des politischen Denkens: der zunehmenden Desillusionierung angesichts bürgerkriegsähnlicher Situation in Italien und der atomaren Bedrohung.
Mehr und mehr verschwinden die linken Melancholiker aus dem Horizont der Geschichte ebenso wie die allmählich alt gewordenen reumütigen Intellektuellen aus der deutschen 68er-Szenerie und schon zuvor jene, die dem Kommunismus als dem Gott, der keiner war, dramatisch abgeschworen hatten und gleichwohl niemals von ihm losgekommen sind. Die Heroiker, die sanftmütig zynischen, raffinierten oder gierigen Hedonisten, die sublimierenden Modernisten und die linken Melancholiker, sie sind allesamt vom Aussterben bedroht. Die Revolution hat aufgehört ein Liebesobjekt, eine Lieb- oder Leidenschaft zu sein, dessen und deren Verlust man melancholisch betrauern könnte. Solche Gesten sind beispielsweise den jungen Globalisierungsgegnern, die mit einiger Unbekümmertheit die fatalen Aspekte des weltweiten Kapitalismus bekämpfen, durch und durch fremd. Wie immer man es literarisch, intellektuell oder ad personam bewerten möchte: Der Abstand zwischen Rosa Luxemburg und Naomi Klein ist unermesslich.
Der Tod der Linken und das Ende der revolutionären Projekte legen nahe, zu Dantons mildem Zynismus zurückzukehren. Als Sloterdijk noch kein waschechter Konservativer war, sondern erkennbar ein gut gelaunter postmarxistischer Linksintellektueller, stellte er dem Zynismus der leeren und schieren Macht den schlauen Kynismus als widerständige, mit sich selbst zufriedene (Über-)Lebensform gegenüber: Leben wie ein Hund. Mit dem raffinierten Dreh, dass es kaum etwas Besseres gebe als dieses Hundeleben. So wie in der ersten Szene von Dantons Tod, freilich ohne Guillotine als negativen Horizont der Geschichte. Einverständnis mit der Empfindlichkeit, Kontingenzbewältigung durch eleganten oder auch weniger eleganten Konsum, die eine Botschaft enthält: Der Kampf ist zu Ende.
Religionen verstehen etwas vom Tod. Mit dem Ende der klassischen mehr oder minder marxistischen Linken steht das Phänomen Tod symbolisch entblößt dar, wenigstens im kulturellen Umfeld jener Menschen, die man höchst provisorisch und in Analogie zu einer Formel des amerikanischen Ästhetikers Arthur Danto als Linke nach dem Ende der Linken bezeichnen könnte: Toskana-Fraktion, neue Verkünder der Menschenrechte, Propagandisten der kleinen Schritte, dramatische Inszenatoren ihrer eigenen konservativen Wende, Wanderer von links nach rechts, Gottsucher, Melancholiker, Arrièregarde und Transavantgarde. Zwischen dem Ende der intellektuellen Selbstkonstruktionen der Linken und der Rückkehr der Religion, der klassischen symbolischen Statthalterin des Todes, scheint ein intrinsischer Zusammenhang zu bestehen. Das Treffen von Jürgen Habermas, dem ungeliebten Erben der Kritischen Theorie, mit Kardinal Ratzinger, dem Chef der päpstlichen Glaubenskongregation, ist in diesem Sinn ein Ereignis. Die Entzauberung einer politischen Religion – und eine solche war der revolutionäre Sozialismus in jedem Fall – und die Wiederkehr eines Religiösen, das eigentümlich unverbindlich, eine subjektive Befindlichkeit bleibt, wie sie schon Friedrich Schleiermacher um 1800 beschrieben hat, bedingen sich gegenseitig. Trotz der Allgegenwärtigkeit von Tod und Gewalt in den Medien, hat der Tod seine konstitutive Kraft eingebüßt, wenigstens für die westlichen Linken, die sich wie alle anderen Zeitgenossen und Zeitgenossinnen Leben und Tod nach der Logik der gängigen “Wellness”-Angebote (das Wort existiert bekanntermaßen im Englischen ebenso wenig wie das “Handy”, gibt aber den Zeitgeist atmosphärisch unnachahmlich genau wieder) symbolisch unspektakulär erträglich zu machen suchen, ohne transzendentes und ohne historisches Heilsversprechen. Einigermaßen. Heimatlos. Mit Péguy und Merleau-Ponty gesprochen leben wir in einer Periode, in der sich die politischen Menschen darauf beschränken, “ein bestehendes Regime oder Recht zu verwalten”, zunehmend gegen eine Gewalt, die von außen auf uns zukommt und die wir, wenn wir aufmerksamer hinblickten, aus unserer eigenen Geschichte kennen müssten.
Zitiert nach Thomas Macho: Todesmetaphern. Zur Logik der Grenzerfahrung. Frankfurt/Main 1987, S. 46.
Jean Améry: Hand an sich legen. Diskurs über den Freitod. Stuttgart 1989, S. 13.
Eric Voegelin: Die politischen Religionen. Herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von Peter J. Opitz. München 1993, S. 11ff.
Karl Marx: Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte (1852). In: Marx Engels Studienausgabe, Bd. IV, Geschichte und Politik 2, herausgegeben von Iring Fetscher. Frankfurt/Main 1966, S. 34.
Georg Büchner: Werke und Briefe. Gesamtausgabe. München 1965, S. 8.
Josef W. Stalin: Geschichte der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (Bolschewki). Kurzer Lehrgang. In Josef W. Stalin: Werke, Bd. 15. Hamburg 1971, S. 447.
Heiner Müller: Die Stücke 2. Frankfurt/Main 2002, S. 243-260.
Maurice Merleau-Ponty: Humanismus und Terror. Frankfurt/Main 1966, S. 10f.
Heiner Müller: Krieg ohne Schlacht. Leben in zwei Diktaturen. Köln 1992, S. 275-282.
Cesare Pavese: Das Handwerk des Lebens. Tagebuch 1935-50. Deutsch von Maja Pflug. Düsseldorf 1988, S. 449.
Published 16 December 2004
Original in German
Contributed by Wespennest © Wolfgang Müller-Funk Eurozine
PDF/PRINTNewsletter
Subscribe to know what’s worth thinking about.