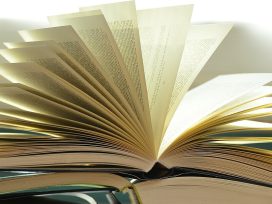Die neue bürgerliche Welt
Zwei Vorfälle aus jüngster Vergangenheit wollen mir nicht aus dem Kopf. Bei beiden dreht es sich um Gewalt. Gewalt ist das Maß dafür, wie stark die Werte und Annehmlichkeiten unterhöhlt sind, die in Ländern, in denen Achtung vor dem menschlichen Leben kaum eine Rolle spielt und oftmals überhaupt nicht vorhanden ist, das Leben der bürgerlichen Mittelschicht ausmachen und bestimmen. Einen Vorfall habe ich anhand von Fakten rekonstruiert, bei dem anderen war ich Augenzeuge. Was mich beunruhigt, sind nicht in erster Linie die haften gebliebenen Bilder, sondern die Art und Weise, in der ich mich jeweils verhielt. Ich spüre einen Machtverlust, ein Vordringen sozialer Impotenz, und mit ihr ein Schwinden jener Fähigkeit zur Anteilnahme, von der ich immer überzeugt war, daß sie denen entgegengebracht werden muß, die unter den Widrigkeiten gesellschaftlicher Randexistenz zu leiden haben. Dabei muß ich nicht ohne Ironie feststellen, daß es vielleicht gerade dieser Machtverlust ist, der es dieser Mittelschicht – welcher Hautfarbe auch immer – erlaubt, in Afrika zu leben. Auch wenn sie nur selten direkte Zielscheibe des Terrors ist, gehört Gewalt doch zu den Rahmenbedingungen ihres Daseins, und sie wird in dem Maße gleichgültiger, in dem sie täglich das Versagen ihrer sozialen Kode erleben muß. Ich bin mir nicht sicher, was diese Verhärtung der Ansichten letzten Endes bedeutet, weder für diese Mittelschicht noch für die Gesellschaft als Ganzes, und schon gar nicht für die Zukunft, auch wenn ich den Verdacht hege, daß sie trotz allem einmal allen zum Vorteil gereichen könnte.
Um von dem ersten Vorfall berichten zu können, ist es erforderlich, die Szenerie etwas genauer zu beschreiben. Das Wetter war perfekt: ein warmer Tag im Frühherbst mit einem unermeßlich blauen Himmel, vor dem sich scharf die Berge abhoben. Ich zog hinüber zu einem Ort am Kap namens Kommetjie – einer kleinen, geschützten Bucht, in der ein paar Hummerboote vertäut sind und Kinder in Kanus herumfahren – um mich einfach ein bißchen auf eine Bank zu setzen, von der aus man dieses friedliche Schauspiel überblicken kann. Unter mir glitt das Meer durch die Felsen hindurch und verströmte diesen beißenden Geruch nach Tang, der für Südafrikas Westküste so kennzeichnend ist. Ibisse stakten auf ihrer Suche nach Läusen und kleinen Krabben durch ein Bett aus Seetangasche, Kormorane spreizten die Schwingen in der Sonne, und hoch oben kreisten Möwen und Seeschwalben. Ich blieb eine Stunde dort und ließ mich von der Wärme und der Schönheit des friedvollen Anblicks einlullen.
Nicht weit von der Bank entfernt, zwischen Steinen und getrocknetem Tang, lag eine leere Weinflasche mit Schraubverschluß. Daneben noch eine weitere, zerbrochen. Unweit davon eine Strickjacke, noch klamm vom nächtlichen Tau. Dazu ein blaßbrauner Rock voller Blutflecken. Man braucht nicht viel Phantasie, um sich ein Bild von dem zusammenzureimen, was sich hier abgespielt hat: ein Mann (oder mehrere) und eine Frau, Alkohol und Gewalt. Bevor ich mich auf die Bank setzte, starrte ich einen langen Augenblick auf die Kleidungsstücke herab und fragte mich, ob sich diese Scheußlichkeit in der vergangenen Nacht ereignet hatte oder schon ein paar Tage eher, und was mit der Frau geschehen war. War sie überfallen worden? Hatte man sie vergewaltigt? Hatte sie entkommen können? Die Kleidung hätte einer Verkäuferin gehört haben können, einer Bankangestellten, einer Studentin. Ich atmete tief durch. Außer diesen wenigen Mutmaßungen (und zu größerer Anteilnahme konnte ich mich nicht aufraffen) schien ich nichts mehr tun zu können. Und welchen Sinn machte es schließlich, sich die Umstände dieses Vorfalls vorzustellen? Ich setzte mich hin und wandte meine Aufmerksamkeit den Vögeln und der Schönheit dieses Tages zu. Trotzdem blieb mir der Rock immer irgendwie im Augenwinkel gegenwärtig.
Zweifellos hätte ich die blutigen Kleider bei der Polizei angezeigt, wenn sich dieser Zwischenfall in Europa ereignet hätte. Dann wären mit Sicherheit eine Akte angelegt und Nachforschungen angestellt worden. In einer Stadt wie Kapstadt aber, mit zehn Morden am Tag und einer Vergewaltigung alle zweiundzwanzig Sekunden und einer unterbesetzten Polizei? Was würde man hier wegen eines feuchten Haufens Kleider im Sand unternehmen, auch wenn sie blutbefleckt sind? Nichts. Und was konnte ich gegen ihr hilfloses Achselzucken ausrichten? Ebenfalls nichts. Mit einem Mal war der schöne Gedanke des Dichters John Donne, daß unsere Menschlichkeit uns mit “dem Tod jedweden Menschens” verbindet, völlig bedeutungslos geworden. In jeder einzelnen Minute ereignen sich einfach zu viele Tode, zu viele Tragödien, als daß man überhaupt noch anfangen könnte darüber nachzudenken, wie sehr wir schon “an Wert verloren” haben – um noch einmal mit Donne zu sprechen.
Dabei ist genau das eingetreten: unsere Fähigkeit zur Anteilnahme ist durch unsere Macht- und Kraftverluste ausgehöhlt worden. Wir sind gewissermaßen in das Exil kleiner Privilegexklaven getrieben worden, aus denen heraus wir uns die Zustände um uns herum mit Trauer und Schrecken ansehen. Mir wurde das wenige Monate später, an einem dunklen Wintermorgen um fünf Uhr, erneut bewußt. Von einem anhaltenden Wehklagen geweckt, das nicht aufhören wollte, bis mir klar wurde, daß die traurige Klage schon seit einiger Zeit in meinen Schlaf drang, trat ich vor das Haus und sah eine Menschenmenge, die sich drei Häuser weiter, am Ende der Straße, versammelt hatte. Sie wurde von den roten Lichtpulsen eines Feuerwehrwagens und den blauen Blitzen eines Polizeiautos beleuchtet. Ein Polizist richtete den schwachen Lichtstrahl seiner Taschenlampe auf einen jungen Mann, der auf dem Dach eines zweistöckigen Fremdenheims kauerte. Der Mann wiegte den Oberkörper hin und her und gab wieder und wieder das Mantra seiner Verzweiflung von sich. Irgend jemand brachte eine Doppelmatratze herbei und legte sie auf den Erdboden. Die Menge brüllte vor Lachen. Möglich, daß sie ihn zum Springen verleiten wollten. In diesem Fremdenheim und dem Haus gegenüber wohnen Flüchtlinge aus den Unruhegebieten Afrikas, junge Männer aus dem Kongo, aus Angola, Rwanda. Auf Gedeih und Verderb den Hausbesitzern ausgesetzt, die hohe Mieten kassieren und sich nicht um die schnell verfallenden Gebäude kümmern, hausen sie in diesen überfüllten Unterkünften. Der Mann auf dem Dach war ohne Zweifel einer von ihnen.
Ich beobachtete, wie er dort hockte, an die Brüstung gedrückt, die Arme um die Knie geschlungen, und seine seltsame, endlose Klage, die über die Dächer schwebte, immer noch mehr Leute zusammentrieb. Pendler auf dem Weg zum Bahnhof drängten sich durch Menge, hielten kurz inne, um zu dem Mann auf dem Dach hinauf zu schauen, und eilten dann kopfschüttelnd weiter oder schlugen mit den Armen als wären sie Vögel. Sie lachten und rissen Witze, wenn sie an mir vorübergingen. Inzwischen hatten die Feuerwehrleute die Leiter bis zur halben Höhe des Hauses ausgefahren. Der trübselige Klagegesang ging weiter. Irgend jemand rief mit mächtiger Stimme, die durch die Straßen hallte, etwas in ein Megaphon. Er schien den Mann Jo-Jo zu nennen. Die Feuerwehrleute schoben die Leiter ein Stück höher. Die Menge wurde still. Die Leiter schwankte und krachte dann mit einem metallischen Geräusch gegen die Brüstung des Daches. Der Mann erhob sich und sprang. Er fiel mit den Füßen voran der Länge nach an der Seite des Gebäudes herunter. Dann ertönte das Geräusch, das ein Ei macht, wenn es vom Ladentisch rollt und auf dem Erdboden zerschellt. Und als hätte sie es einstudiert, als folgte sie der Choreographie eines seltsam anmutenden Balletts, stöhnte die Menge auf und wich zurück und wandte sich der Stelle zu, an der der Mann aufgeschlagen sein mußte.
Ich sah den Mann fallen, ich hörte das schmatzende Klatschen seines Aufschlages. Noch immer habe ich das Bild vor Augen und den Klang im Ohr. In dem Augenblick, in dem es geschah, bedeckte ich das Gesicht mit den Händen und schloß einen Moment lang vor Entsetzen die Augen. Fünf Minuten später hatte der Krankenwagen bereits den Leichnam weggefahren, und ich ging wieder ins Bett. Bezeichnender noch: ich schlief wieder ein. Was ich miterlebt hatte, hatte mich berührt, und dennoch besaß ich die Fähigkeit, schnell wieder in den Schlaf zu fallen.
Tage später fand ich bei den Flüchtlingen heraus, daß der Mann aus Angola stammte. Man gab mir diese Information, als wäre damit sein Verhalten erklärt. Er hatte keine Freunde hier, bedeutete man mir. Vielleicht hatte er auch keine Familie. Vielleicht war auch der Krieg in seinem Heimatland schuld. Vielleicht aber war es auch sein Kopf. Und die Männer, die mir mit diesen barschen Erklärungen kamen, tippten sich an die Schläfen. Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht. Niemand wußte es genau. Niemand wußte, wie er auf das Dach gelangt war, oder warum er gesprungen war, oder worüber er so geklagt hatte. Niemand wußte, wo er beerdigt worden war, oder wer davon zu benachrichtigen gewesen wäre, daß er gestorben war. Während ich mich mit den Männern unterhielt, die sich in der Wintersonne wärmten, gewann ich den Eindruck, daß da nicht einmal ein klein wenig Trauer vorhanden war, sondern lediglich Hinnahme. Sie standen in der Gegend herum und redeten über Fußball und Frauen oder bastelten an ihren Autos, und die Tatsache, daß erst vor kurzen jemand von dem Dach hinter uns in den Tod gesprungen war, schien nur geringe Bedeutung zu haben. Vielleicht liegt es daran, wo sie herkommen und welche tragischen Geschichten nur zu oft ihr Leben ausmachen, daß ein neuerlicher Todesfall für sie eben bloß ein weiterer Todesfall ist.
Genau das ist der Punkt, so glaube ich, an dem die Werte der bürgerlichen Mittelschicht – Werte, die sich zum einen über das gesamte politische Spektrum erstrecken, gleichzeitig aber zum größten Teil auf dem allgemeinen Einvernehmen basieren, daß Rücksichtnahme auf andere und Achtung des menschlichen Lebens eine wesentliche Rolle spielen, wenn die Gesellschaft funktionieren soll – gegen die Wirklichkeit einer Hobbeschen Welt stehen, in der das Leben oft genug ärmlich, schmutzig, verroht und kurz ist.
Wie schmutzig und wie verroht, wurde mir aufs neue klar, als ich für eine Artikelserie über das Gesundheitswesen in Kapstadt recherchierte. Mit einem Mal offenbarte das, was ich sah, was man mir erzählte, die ganze Zweifelhaftigkeit der Überzeugungen der bürgerlichen Mittelschicht, und wie weit diese Mittelschicht von den drängendsten sozialen Problemen entfernt ist, wie isoliert sie dasteht. Ich begriff aber auch, daß diese Mittelschicht, wenn sie denn weiterhin hier leben und ihren Beitrag zur Entwicklung der Gesellschaft leisten will, ihr Herz mit einem Panzer umgeben muß. Die Alternativen sind Paranoia oder Flucht. Wie oft haben Europäer mir gesagt: “Hier könnte ich nicht leben, die Wirklichkeit ist zu grauenvoll”. Sie ist es. Südafrika nimmt zum Beispiel unter den fünfundneunzig Mitgliedsstaaten der Interpol bei Mord, Vergewaltigung und Raubüberfall jeweils den ersten Platz ein. Totschlag ist die dritthäufigste Todesursache in Kapstadt. Von der Polizei geführte Statistiken beweisen, daß die Rate der Vergewaltigungen, Belästigungen und Kindesmißhandlungen auf einhunderttausend Einwohner höher als irgendwo sonst im Land ist. Autopsieberichten unnatürlicher Todesfälle zufolge, war in neunzig Prozent der Fälle Alkoholmißbrauch im Spiel. Als Spiegelbild des Geisteszustandes eines Teils der Gesellschaft tragen diese Statistiken alarmierenden Charakter.
Einen noch größeren Eindruck hinterließ die Aussage des Verkehrspolizisten Sergeant Ncamile Mase bei mir. Während wir über das außerordentlich hohe Maß der Gewalt sprachen, der er sich im täglichen Dienst gegenübersieht, berichtete er von folgender Begebenheit:
Einmal sahen wir während der Nachtschicht einen großen Laster im Busch parken. Im Laster saß ein Mann, ein zweiter stand daneben. Wir fuhren näher heran und sprachen sie an, und sie meinten, es gäbe keinerlei Schwierigkeiten, sie würden nur ein paar Bier trinken und ein bißchen abhängen. Als nächstes höre ich, wie der Mann im Laster in Xhosa zu dem anderen sagt, daß er uns dazu bringen soll zu verschwinden. Also springe ich aus dem Wagen und ziehe meine Waffe, und als ich mir die Ladefläche des Lasters ansehe, da ist dort noch ein dritter Mann, der vergewaltigt ein Mädchen. Das Mädchen ist von allen dreien vergewaltigt worden. Als sie mir ihre Geschichte erzählt, stellt sich heraus, daß sie in Gugulethu auf dem Weg nach Hause war, als sie neben ihr anhielten und sie fragten, ob sie wüßte, wo sie Bier kaufen könnten. Sie antwortete, sie könnte ihnen einen Ort ganz in der Nähe zeigen. Dann steigt sie in den Laster, und sie fahren geradewegs in den Busch und vergewaltigen sie. Das Mädchen ist dumm. Man fährt nachts nicht mit Fremden mit. Man fährt überhaupt nicht mit Fremden mit.
Ich will Ihnen noch was erzählen. Stellen Sie sich vor, daß ein paar Kerle in die Shebeen gehen und dort was trinken, und dann geht einer den anderen um eine Zigarette an, und der sagt nein. Dann kann es passieren, daß er umgebracht wird, weil er nein gesagt hat. Wegen so einer Winzigkeit. Oder wenn jemand mit seinem Drink seinem Freund ans Knie stößt, dann kann er wegen dieser Kleinigkeit umgebracht werden. Es ist schrecklich. Und diese Kerle sind alle miteinander befreundet. Ich würde sagen, es kommt vom Trinken, oder vom Neid, oder wegen eines Mädchens, daß diese Männer zu Mördern werden. Sie haben keinerlei Achtung mehr. Keinerlei Achtung. Ich bin mittlerweile achtzehn Jahre bei der Truppe, aber was jetzt geschieht, diese Morde und Vergewaltigungen, es sind so viele. So was ist früher auch passiert, aber viel weniger häufig. Es sind inzwischen so viele, das ist der Unterschied. Es ist überall. Ich möchte meinen, daß irgend ein Teufel im Volk umgeht. Wir in der Polizei befinden uns im Augenblick in einem großen Krieg.
Man muß keine Kriminologen und Psychologen bemühen, um die Statistiken zu interpretieren, und schon gar nicht die Berichte von Sergeant Mase über die häufigen Gewalttaten, mit denen er täglich zu tun hat: das alles sind Merkmale einer Gesellschaft, die sich in einem Trauma befindet. Einem Trauma, das seine Wurzeln in einer Krankheit hat, einer Teilnahmslosigkeit, einer Depression, die ebenso auf die koloniale Geschichte des Landes zurückzuführen ist wie auf die Kräfte des Weltmarktes, die sich wild auf die kleinen Ökonomien stürzen. Das wird nirgendwo deutlicher sichtbar als in den Ghettos der Wohnblöcke von Manenberg zum Beispiel. Errichtet, als Menschen, die man als “Farbige” eingestuft hatte, gewaltsam aus ihren Häusern in der Nachbarschaft von Kapstadts Zentrum umgesiedelt wurden, ist Manenberg heute Kriegsgebiet – eine Gegend, um die sich rivalisierende Gangs beständig schlagen. Mir kommt es wie eine Nachahmung der Apokalypse vor, eine Sequenz aus dem Film Blade Runner. Um neun Uhr morgens stehen überall die Männer in Gruppen herum: sie lungern vor Hoftoren, stehen an den Ecken, lehnen gegen Pfosten. In den Straßen herrscht Leben, sie sind lärmvoll mit tobenden Kindern und Hunden und Frauen, die das Haar unter ihren Schals in Lockenwickler gedreht haben und rauchend die Szenerie beobachten. Und dennoch sieht die ganze Gegend aus wie das Nachspiel zu einem Krawall: die Straßen sind mit Steinen und Halbziegeln und zerschlagenen Flaschen und Kleidungsfetzen übersät. An diesem Morgen fährt Mariette Williams, eine Sozialarbeiterin, die sich auf Tuberkulosevorsorge spezialisiert hat, mit mir durch diese Gegend. Mit 560 Patienten auf einhunderttausend Einwohner hat Kapstadt bei Tuberkulose die höchste Krankheitsrate der Welt. Wir starten am Krankenhaus. Es ist von einem hohen Zaun aus Betonpfeilern umgeben und hat ein Automatiktor. Der Zaun und das Tor sind errichtet worden, um zu verhindern, daß die Gangster in ihren Kriegen das Krankenhaus zum Teil des Schlachtfelds machen. Das Geld, das in diese Sicherheitsmaßnahmen geflossen ist, hätte man wesentlich sinnvoller für Arzneimittel ausgeben können. Egal.
“Der Zaun ist schlimm”, zuckt Mariette die Achseln, “aber das ist unsere Lebenswirklichkeit hier. Natürlich ist er auch dazu da, die Leute davon abzuhalten, hier einzubrechen und zu stehlen. Wir haben jetzt auch einen Wachmann, weil wir es uns nicht leisten können, daß das Krankenhaus diesen Vandalen zum Opfer fällt. Wir müssen es in Betrieb halten.” Wir fahren durch die Straßen, vorbei an einer Reihe ausgebrannter Läden, deren Besitzer sich geweigert hatten, Schutzgeld an einen Bandenchef zu zahlen, dann mit Gewalt zum Schließen gezwungen und schließlich geplündert worden waren. Wir kommen an einem riesigen Graffiti vorüber, das ganz dunkel und drohend aussieht. Ein anderes stellt die Gangsterikone Tupac Shakur dar. Wir fahren an einem Hund vorüber, der im Rinnstein liegt, und sie sagt, daß er schon zwei Tage dort läge. Er zuckt noch. “Das ist wie eine Krankheit hier”, sagt Mariette. “Als ob die ganze Gemeinschaft unter einer Depression leidet.” Sie hält inne.
Ich bin nicht ängstlich, aber vor ungefähr einem Jahr saß ich einmal im Krankenhaus, als ich eine Schießerei hörte. Das waren schwere Waffen, und es war das erste Mal, daß ich Angst bekam. Wenn ich heute mitbekomme, daß es irgendwo Zoff gibt, rufe ich die Polizei an, damit sie herausfindet, was los ist. Und wenn ich hier in der Gegend bin, dann bin ich vorsichtig. Ich beobachte, was auf den Straßen los ist, ich fahre mit geschlossenen Fenstern, ich habe die Autotüren verriegelt, solche Dinge. Wenn es ganz ruhig ist oder aber wenn flotte Autos durch die Gegend fahren, dann weiß man, daß es Zoff geben wird. Das einzige, worüber ich mir manchmal Sorgen mache ist, daß es so etwas wie einen Notplan geben müßte, damit meine Arbeit weitergehen kann. Für den Fall, daß ich hier erschossen werde. Und mit erschossen werden meine ich nicht, daß man mich bewußt aufs Korn nimmt, sondern daß ich in einen Schußwechsel gerate.
Sie sagt das, als würde sie etwas völlig normales erzählen. Und trotzdem frage ich mich, wie viele Leute wohl eben diese Überlegungen im Hinterkopf haben, wenn sie ihrer täglichen Arbeit nachgehen.
Mariette Williams gehört zur Mittelschicht. Sie ist jung, attraktiv, humorvoll, Absolventin der Universität Kapstadt. Nach rassischen Gesichtspunkten geurteilt ist sie eine Farbige; ich bin Weißer. Wir wuchsen auf verschiedenen Seiten der Barrikade auf – ungeachtet der Apartheid – und dennoch verstehen wir uns völlig. Wir haben die selben Werte, wir leben nach den selben Regeln, wir haben ähnliche Vorstellungen von der Gegenwart und der Zukunft. Wir sind uns schmerzlich der Ablehnung bewußt, die – mitunter körperlich, immer aber gefühlsmäßig – der Mittelschicht entgegenschlägt.
Vor ein paar Jahren hörte ich den Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger über die Ausbreitung der Bürgerkriege in der Welt sprechen. Damals machte er auf dem Erdball über dreißig solcher Kriege aus und bezeichnete sie als “molekulare Bürgerkriege” – Kriege, die nicht aus politischen Gründen heraus geführt werden, sondern von Menschen, zumeist Männern, die ins Abseits getrieben wurden, wo Kriegsfürsten und Drogenbarone die Macht innehatten. Es handelt sich zudem um Kriege, die – infolge der Flüchtlingsströme in den letzten fünfzig Jahren – an weit vom Ursprungsland entfernten Orten ebenso leicht ausbrechen können wie am Ursprungsort selbst. Diese Beschreibung trifft auf Manenberg und die gewaltsamen Auseinandersetzungen der Gangs und Banden, die dort ihren Ursprung haben, zu. Wie berechtigt sie ist, kommt auch in den Raubüberfällen in den Vorstädten zum Ausdruck, wo Vergewaltigung und Mord oftmals Bestandteil der Plünderungen sind – und hier verwende ich absichtlich das Wort Plünderung, das normalerweise mit Kriegen assoziiert wird. Enzensberger ging noch weiter und wies darauf hin, daß diese Bürgerkriege nicht notwendig gegen ein Staatswesen geführt werden. Es handele sich vielmehr um eine Art Gewalt, die darauf abziele, den Aufbau und die Struktur einer Gesellschaft zu zerstören, und nicht aufhöre, bevor diese Zerstörung erreicht sei. Diese Bürgerkriege würden von Menschen ausgetragen, die von “blinder Gewalt” zerfressen würden, die um des Kämpfens willen kämpften. Auch wenn es Ziel eines Landes wäre, etwas aufzubauen und in seiner Entwicklung voranzuschreiten, könnten diese Nischen des Bürgerkriegs die ganze Gesellschaft in Mitleidenschaft ziehen. Doch, so behauptete er, wenn man davon ausginge, daß “nicht alle Amok laufen”, daß “nicht alle Menschen alle anderen umbringen wollen”, dann könnte “die Mehrheit in der Lage sein, die Basis der sozialen Interaktion zu verteidigen”. Und das wird sie ohne Zweifel tun. Dennoch empfindet diese Mehrheit, wie Enzensberger auch, daß in der ganzen Welt “die sicheren Regionen schrumpfen”. Dieses Gefühl vermag vielleicht niemand besser zu empfinden als die Mittelschicht in Südafrika und anderen Regionen des afrikanischen Kontinents.
In seiner Analyse der Einstellung der Schwarzen zum Outlaw als Helden, artikuliert der Schriftsteller Zakes Mda – der schon vor langer Zeit zum Bewohner einer bürgerlichen Vorstadt wurde – die Einstellung der Mittelschicht zur Kriminalität. Er schreibt:
Ich bin davon überzeugt, daß wir es vermieden haben, die wirklichen Ursachen der Kriminalität zur Kenntnis zu nehmen, weil sie von Einfluß sind auf unseren Wert als schwarze Menschen in den städtischen Gebieten. Statt dessen haben wir alles auf die Armut geschoben. Es kam uns nicht in den Sinn, einmal die folgende Frage zu stellen: wenn Armut die Ursache der Kriminalität ist, warum hat dann die ärmste Provinz Südafrikas, die Northern Province, die niedrigste Kriminalitätsrate und Gauteng, die reichste Provinz, die höchste? Man kann die selbe Frage mit Blick auf Länder wie Zimbabwe stellen, wo nicht nur die Städte sauberer sind als in Südafrika, sondern auch die Gesetzeshüter größeren Respekt genießen. Zimbabwe aber ist ein ärmeres Land als Südafrika. Keine Frage, es gibt in Südafrika Kriminalität, die in Armut und Hunger ihren Ursprung hat. Der weitaus größte Teil der Verbrechen jedoch ist das Ergebnis unserer Gier und des Wetteiferns um materielle Besitztümer. Geldgeile Gangster und die Bosse von Drogensyndikaten hungern nicht. Sie sind Multimillionäre.
Mdas Kommentar mag sich auf Schwarze beziehen und an sie richten, doch trifft er ebenso auf die anderen rassischen Gruppierungen in Südafrika zu.
Auch wenn man die bürgerliche Mittelschicht nicht als den strahlenden Gipfel allen gesellschaftlichen Strebens bezeichnen kann – in den meisten afrikanischen Ländern werden sowohl der private als auch der staatliche Sektor in einem Maße von Korruption zerfressen, daß sich zum Beispiel das Black Management Forum in Südafrika gezwungen sah, seinen Mitgliedern einen Moralkodex aufzuerlegen, auch wenn sich der Filz durch alle rassischen Gruppen zieht – so ist die Mittelschicht doch einer der sichtbarsten und notwendigen Faktoren einer modernen Wirtschaft. Ihre Angehörigen sind berufstätig, verfügen über Kaufkraft, besitzen Bildung, haben Zugriff auf die Technik und wissen, wie sie an Informationen gelangen und die Aufmerksamkeit erregen, von der ihr Lebensstil profitiert. Sie kaufen Bücher und Kunstwerke, gehen ins Kino, ins Theater, in Konzerte, in Restaurants. Sie leiten Unternehmen, gründen Firmen, produzieren Wohlstand, nicht nur für sich, sondern auch für ihre Angestellten. Sie zahlen darüber hinaus beträchtliche Steuern, leisten einen großen Beitrag zu den Krankenkassen und zur Rentenversorgung. Sie bemühen sich auf vielfältige Weise – recht eigentlich sind sie sogar dazu gezwungen – sich von den Wohlfahrtsprogrammen des Staates unabhängig zu machen, weil diese in zunehmendem Maße den Menschen mit geringem oder gar keinem Einkommen vorbehalten bleiben müssen. Es ist eigentlich ganz einfach: als Angehöriger der Mittelschicht kann ich keine Staatsrente erwarten, wenn ich mich zur Ruhe setze, noch wird mir der Staat zu Hilfe kommen, wenn ich krank werde. Die Mittelschicht ist dazu gezwungen, finanziell auf eigenen Füßen zu stehen. Dabei muß sie sich der Gnade einer launischen Börse anheim geben, an der man sein Geld ebenso schnell verlieren kann, wie man es gewinnt.
Die Mittelschicht hat zum größten Teil keine Ahnung von dem, was um sie herum vor sich geht. Sie bewegt sich zwischen den Vorstädten, den Einkaufsmeilen und den Bürobezirken der Großstädte hin und her und könnte ebenso gut in den Großstädten Nordamerikas, Europas oder Australiens leben. Sie braucht sich nicht in die Schlangen vor den Ambulatorien einzureihen. Ihre Kinder besuchen gut ausgestattete Schulen. Sie kommt nicht mit den Straßenkindern in Berührung. Sie muß das Blut und den Horror nicht erleben. Doch selbst in diesen hoch privilegierten Bereichen ist die Mittelschicht nicht völlig sicher. Im Gegenteil, sie ist es immer weniger. Die Botschaft der Furcht dringt bis zu ihr durch. Botschaften, die sie durch die Informationsmedien erreichen und von einem bekannten Pressefotografen berichten, der in seinem Haus von einem vierzehn Jahre alten Eindringling erstochen wurde. Oder Informationsblätter wie das, das mir gerade von meiner Versicherung ins Haus geflattert ist und rät: “Verkürzen Sie die Zeit, die einem Einbrecher bleibt, ein Verbrechen zu begehen, indem Sie adäquate Sicherheitssysteme installieren. Erschweren Sie es dem Einbrecher, indem Sie sein Zielobjekt so sichern, daß es ihn große Anstrengung kostet, in das Haus einzudringen. Alle öffnenden Fenster sollten durch massive Gitter, die an die Innenseiten der Rahmen geschweißt oder in der Wand verankert sind, gegen Einbruch gesichert werden. Installieren Sie an Schiebetüren entweder Spezialschlösser oder statten Sie sie mit Sicherheitstoren aus. Außentüren müssen stabil aus massivem Holz gebaut und Hohlkerntüren durch Metallverkleidungen geschützt sein.” Die Sprache, ungeachtet von Inhalt und Zweck, ist die Sprache des Krieges.
Solche Botschaften erreichen uns ständig, und sie werden noch ausgeschmückt: sie werden auf Dinnerparties weitererzählt, in den Büros und Cafés, und sie verstärken die Wahrnehmung, daß die sicheren Gebiete kleiner werden. Dein Haus ist nicht mehr sicher, die Straßen sind gefährlich, sogar die Schule, die dein Kind besucht, kann in einen solchen molekularen Bürgerkrieg hineingezogen werden. Mir wurde zum Beispiel vor kurzem von einer anständigen, liberalen Mutter aus der Mittelschicht erzählt, daß ihr vier Jahre alter Sohn in einem anständigen, liberalen Mittelschicht-Kindergarten von einem sechs Jahre alten Spielgefährten sexuell belästigt worden sei. Dieses Trauma nun wurde noch von rassischen Gesichtspunkten überlagert: der jüngere der beiden Jungen ist weiß, der ältere von schwarzer Hautfarbe. Bekomme ich solche Geschichten zu hören, dann sehe ich eine tiefe Bruchlinie der Schuld durch die Gesellschaft gehen, einen Riß, der in die Tiefen unserer Geschichte reicht. In diesem Zusammenhang aber ist wesentlicher, daß die Eltern hohe Beiträge zahlen müssen, um ihre Kinder in diesen Kindergarten schicken zu können. Geld ist – oder besser: war – eines der wirkungsvollsten Instrumente der Mittelschicht zum Schutz der eigenen Interessen. Sie konnte sich ihren Gesellschaftsanteil erkaufen. Vielleicht waren auch die Eltern des schwarzen Jungen der Ansicht, daß sie sich eine solche Teilhaberschaft erkauft hatten. Möglicherweise war der Schutz, den das Geld bot, immer mehr Illusion als Wirklichkeit, und vielleicht haben sich auch solche Vorfälle wie der auf dem Spielplatz früher schon zugetragen, waren Einzelfälle und entbehrten des rassischen Untertons. Jetzt aber vergrößert ein solcher Vorfall den Angstquotienten. Inzwischen erscheint er als weiteres Glied in einer Kette uns schwächender Angriffe, die langsam aber gnadenlos unsere individuellen Abwehrkräfte vernichten.
Die Angst vor gewalttätigen Übergriffen ist heute allgegenwärtig. Eine befreundete Ärztin kehrte vor kurzem von einer Praxisvertretung aus England zurück und spricht von ihrem dreimonatigen Aufenthalt dort als einer angstfreien Zeit. “Uns ist überhaupt nicht klar, wie sehr unsere Tage von Vorsicht bestimmt werden”, sagt sie. “Immer schauen wir über die Schulter nach hinten.” Das stimmt natürlich. Ich kenne Leute, die sogar zu Hause den Alarmknopf tragen, über den sie mit Einheiten von Armed Response verbunden sind. Es gibt sogar Polizeiwachen, die mit den privaten Abteilungen von Armed Response verkabelt sind. Diese Zustände sind nicht einzig in Südafrika gang und gäbe, es gibt sie überall auf der Welt. Beunruhigend ist die Art dieser Furcht. Sie stellt die dünne Linie dar, die vorübergehende Angstzustände von Paranoia und Neurose trennt. Im Augenblick ist es Mode, diese Furcht dadurch zu verbergen, daß man Südafrika als Land im Umbruch bezeichnet, als dynamische Gesellschaft, die darum ringt, sich selbst neu zu gestalten. Wenigstens ist das Leben nicht langweilig, heißt es. Seht euch Europa und die Vereinigten Staaten an, sagt man, bei denen ist das Leben auf Trivialitäten und Spektakel reduziert. Wir dagegen setzen uns mit grundlegenden menschlichen Angelegenheiten auseinander, mit den großen Themen. Das tun wir unbezweifelbar, doch auch wenn wir das behaupten, wissen wir doch gleichzeitig, daß unsere Macht, etwas zu verändern, geringer geworden ist. Dabei rede ich nicht von Macht im politischen Sinne, sondern von der Macht der Institutionen und Systeme, in Gesellschaften optimal zu funktionieren, in denen die Ungleichheiten zwischen den Besitzenden und den Besitzlosen offen zu Tage treten und immer größer werden. Nehmen wir zum Beispiel das Rechtssystem. Vor kurzem zahlte eine kleine Dorfgemeinschaft die Kaution für einen Mann, der sich wegen eines Mordes in Untersuchungshaft befand. Sobald er sich wieder auf freiem Fuß befand, wurde er vor ein illegales Gericht gestellt und hingerichtet. Die Dorfbewohner waren von der Schuld des Mannes überzeugt und besaßen keinerlei Vertrauen in den normalen Gang der Gesetzlichkeit. Im ganzen Land greifen Selbstschutzgruppen in wachsendem Maße zur Selbstjustiz. Was sicher verständlich, doch aus dem Blickwinkel der Mittelschicht heraus nur schwer hinzunehmen ist.
Natürlich ist unsere Gesellschaft bislang alles andere als zusammengebrochen: wir verfügen über ein Parlament, Provinzregierungen, Stadträte; Großstädte, Einkaufszentren, Kommunikationsnetzwerke, internationale Flughäfen, eine Börse; das Gesundheitswesen funktioniert noch; es gibt Schulen und Lehrer, Gerichte und Polizei, Straßen werden gebaut und instand gesetzt; all die Elemente und Faktoren, die eine moderne Wirtschaft ausmachen sind vorhanden und funktionstüchtig. Oder besser: sie sind mehr oder weniger vorhanden und arbeitsfähig. Es ist das Maß ihrer Funktionstüchtigkeit und Wirksamkeit, das die Mittelschicht so frustriert. Und alarmiert. Wenn man einmal die Polizei braucht, kann es mitunter sehr lange dauern, bis sie kommt, wenn sie überhaupt kommt. Zu viele Klassenzimmer sind überfüllt, weil in der Folge von Etatkürzungen Lehrer entlassen werden mußten. In diesen Schulen gibt es häufig keine Lehrbücher, keine Übungsmaterialien, manchmal nicht einmal Stifte für die Schüler. Die Ärzte in den staatlichen Krankenhäusern müssen in den fünf Stunden, die die Ambulatorien täglich geöffnet sind, häufig sechzig Patienten behandeln. Oftmals kommt es zu Engpässen bei Medikamenten. Mitunter müssen sogar Kopfschmerztabletten auf zehn Stück pro Patient und Monat rationiert werden. Es ist nicht schwer, eine solche Klageliste aufzustellen. Sie könnte auch das außerordentliche Größenwachstum der illegalen Slumsiedlungen nicht nur vor den Toren der Großstädte, sondern auch in der Nähe der Kleinstädte auf dem Land und nahe der Dörfer umfassen. Alles würde letztlich eine rein arithmetischen Angelegenheit werden, wollte man darauf hinweisen, daß in einem Land wie Südafrika vierzig Millionen Menschen leben, von denen eine Million Arbeit hat und Einkommenssteuer zahlt, und über fünfzehn Millionen Menschen j nger als achtzehn Jahre alt sind. Für so wenige Beschäftigte ist es sehr schwierig, ausreichend zu einer modernen Wirtschaft beizusteuern, die vor der Aufgabe steht, die Lebensbedingungen so vieler Menschen zu verbessern. Dabei habe ich noch nicht einmal den außerordentlichen Einschnitt erwähnt, zu dem – den Vorhersagen zufolge – AIDS in den nächsten zehn Jahren in Gesellschaft und Wirtschaft führen wird.
Trotz dieser Unsicherheiten und Veränderungen hat sich die Mittelschicht aber noch nicht aufgegeben. Im Gegenteil. Für diejenigen, die entlang der Weinroute ihren Chardonnay nippen oder in den Straßencafés sitzen oder sich in ihren Gärten in der Sonne entspannen, signalisiert die häufig zu hörende Bemerkung, “Afrika ist die Hölle”, in keiner Weise, daß ein Sektor der Gesellschaft vor der Verzweiflung steht. Dabei muß man sich vor Augen halten, daß die Mittelschicht, ungeachtet der Schlagzeilen in den Zeitungen, zum größten Teil immer noch ein königliches Leben führt, wie mir ein Kellner kürzlich vorhielt. Keine Frage, die Leute bestimmen ihren Standort neu und suchen sich sicherere Gegenden. Für mich persönlich bedeutete das, mein Haus in Muizenberg – wo ich sechzehn Jahre lang gewohnt habe – zu verkaufen, weil ich den wachsenden Lärm, den Schmutz und die Erniedrigung nicht länger ertragen mochte, und ein Haus in einer Gegend zu erwerben, die sozial stabil ist. Für mich und viele andere gehört eine Verhärtung der Einstellung, der Verlust der Fähigkeit zur Anteilnahme zu dieser Neubestimmung des Standortes, weil das Ausmaß der sozialen Probleme unsere individuellen Möglichkeiten weit übersteigt.
Im Augenblick, da ich das schreibe, erreicht mich die Nachricht, daß am vergangenen Wochenende sechs Mädchen vergewaltigt worden sind. Ein Mädchen ist von vier Gangstern aus dem Haus ihrer Eltern gezerrt und vergewaltigt worden. Es war Teil der Aufnahmeriten in die Gang. Dann stachen sie zweiundvierzig Mal auf sie ein. Sie lebte noch lange genug, der Polizei die Namen ihrer Peiniger zu nennen. Die Reaktion in den Talk-Shows im Radio waren Wut und wiederholte Forderungen nach Wiedereinführung der Todesstrafe. Zwei meiner Freunde, die sonst vehement gegen die Todesstrafe eintreten, forderten die Hinrichtung der Verbrecher. Sie können nach wie vor und ebensowenig wie ich die Wiedereinführung der Todesstrafe gutheißen, doch ebenso wie ich fordern sie Vergeltung, auch wenn sie sich nicht dazu durchringen können, dieses Wort zu benutzen. In solch einer Atmosphäre ist es nahezu unmöglich, in philosophischem Sinne konsequent zu bleiben: wir leben – und es geht nicht anders – viel zu gefühlsbetont. Wir brauchen eine dickere Haut.
Published 18 November 1999
Original in English
Translated by
Thomas Brückner
First published by Wespennest
Contributed by Wespennest © Mike Nicol / Thomas Brückner / Wespennest / Eurozine
PDF/PRINTNewsletter
Subscribe to know what’s worth thinking about.