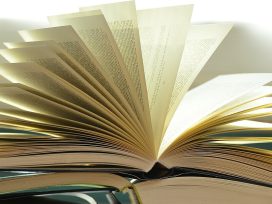Sieben Momentaufnahmen aus der "zivilisierten Welt"
Eins
Kapstadt. Ein Brief vom Deutschen Akademischen Austauschdienst erreicht mich, die Einladung, das nächste Jahr mit einem Schreibstipendium in Berlin zu verbringen. Ich bin ziemlich aufgeregt. Meine Partnerin ebenso. Auch wenn dies bedeutet, dass wir Jahresvisa beantragen müssen. Aber unter diesen Umständen sollte das wohl nur eine Formsache sein. Oder?
Ungefähr eine Woche, nachdem wir beim hiesigen deutschen Konsulat unsere Visaanträge eingereicht haben, geht meine Lebensgefährtin an den Apparat, als das Konsulatsbüro anruft.
“Das Visum für Mr. Nicol ist überhaupt kein Problem”, teilt man ihr mit, “aber Ihr Visum ist abgelehnt worden.”
Meine Partnerin lacht, allerdings etwas beunruhigt. Sie meint, dass es sich nur um einen schlechten Scherz handeln kann.
“Nein, das ist kein Scherz”, sagt die Konsulatsangestellte.
“Aber warum die Ablehnung”, fragt eine sprachlose und den Tränen nahe Lynette (das ist nicht ihr richtiger Name; der wird aus Gründen der Paranoia und aus Angst vor der schwarzen Liste in der Fremde geheim gehalten.)
“Es geht darum, dass sie nicht verheiratet sind”, ertönt die Antwort.
“Wir schreiben aber das Jahr 1996. Und wir leben jetzt seit sechzehn Jahren zusammen”, bricht es aus Lynette hervor. “Wir haben gemeinsame Bankkonten. Und wir haben ein gemeinsames Testament.”
“Das ist unerheblich”, teilt man ihr mit. “Sie sind nicht verheiratet. Tut mir Leid, aber Ihr Name steht jetzt auf der Schwarzen Liste.”
Zwei
Berlin. (Lynette hat es “ins Land geschafft”, doch erscheint ihr Name weder auf den Klingelschildern an Haus- und Wohnungstür noch ist sie, wie ich, polizeilich gemeldet. Wir fragen uns, ob die Polizei nicht vielleicht ab und an zu Durchsuchungen schreitet, um herauszubekommen, wer wo wohnt.)
Ich stehe bei Kaisers, dem kleinen Supermarkt ganz in der Nähe unserer Wohnung, in der Schlange an der Kasse. Mein ganzes Leben lang habe ich in Supermärkten eingekauft und nie jemanden in der Schlange an der Kasse angesprochen. Noch hat mich jemals jemand aus der Schlange beleidigt oder gar angebrüllt.
Doch als ich meine wenigen Einkäufe auf das Transportband lege, fange ich einen Blick der Frau hinter mir auf. Ihr Gesicht ist vor aufgestautem Groll und Missmut braunrot angelaufen. Jetzt explodiert sie und schimpft auf mich ein. Ich sehe sie an, völlig überrascht von dem Ausbruch. Die Kassiererin ignoriert diesen gehässigen Angriff, die Leute in der Reihe hinter der verrückten Frau üben wahrscheinlich Kopfrechnen.
Die Feindseligkeit der Frau ist derart groß, dass ich mich, in dem verzweifelten Versuch zu begreifen, welche Regeln ich aus Unkenntnis gebrochen habe, krampfhaft bemühe, ein paar Wörter von dem, was sie sagt, zu verstehen. Ich schnappe “Krankenhaus” auf, aber ansonsten klingt alles nur deutsch. Ob sie nun auf dem Weg ins Krankenhaus ist, oder ob ich ins Krankenhaus soll, vermag ich nicht auszumachen. Ich sage ihr, mit den wenigen Worten Deutsch, über die ich gebiete, dass ich sie nicht verstehe. Sie schimpft immer weiter. Eilig zahle ich bei der Kassiererin – die immer noch so tut, als ob nichts Unnormales vor sich ginge – und noch eiliger stopfe ich meine Lebensmittel in die Tasche. Dann fliehe ich.
Drei
Ich bin mit dem Bus auf dem Weg zum Flughafen Tegel. Die Ablage war voller Gepäckstücke und deshalb musste ich meinen Koffer in dem Bereich abstellen, der normalerweise Kinderwagen vorbehalten ist. Weil der Bus überfüllt ist, bleibe ich neben meinem Koffer stehen. An einer Haltestelle steigt eine junge Frau mit Kinderwagen zu. Mit einem Blick erfasst sie die Situation und beschließt vernünftigerweise, mir nicht die Knöchel zu brechen, nur um ihr Recht durchzusetzen. Einer anderen Mitreisenden ist das allerdings gar nicht recht. Sie kehrt sich zu mir um und beginnt lautstark mit mir zu schimpfen, weil ich so sorglos die Regeln verletzt habe.
Ich habe nicht die Spur einer Ahnung, was die Frau sagt, aber sie redet eine ganze Menge. Jedenfalls kriege ich mit, was sie meint. Doch je mehr ich sie ignoriere, desto mehr regt sie sich auf, heischt Unterstützung bei ihren Landsleuten und fordert sogar den Fahrer auf, über diese grobe Verletzung der Menschenrechte zu richten. Die junge Mutter lächelt mich verunsichert an. Ich verstehe ihr Lächeln als Verlegenheit. Die aufgebrachte Frau regt sich unvermindert weiter auf. Selbst beim Aussteigen macht sie mir noch Vorhaltungen. Und während der Bus weiterfährt, kann ich sehen, wie sie mit ihren Mitreisenden aufgeregt mein Vergehen diskutiert.
Vier
London, Flughafen Heathrow. Mein dritter Besuch bei Freunden in diesem Jahr. Der Angestellte der Einwanderungsbehörde betrachtet mich, sieht in meinen Pass, durchblättert die Seiten, die mit Visa verziert sind. Jedes Mal, wenn ich meine Heimat verlassen will, brauche ich ein Visum. Das ist eine kostspielige Angelegenheit, aber ich liebe meinen Schatz an verschiedenen Visa ebenso sehr wie ein Briefmarkensammler seine Briefmarkensammlung.
“Sie waren im Mai schon mal hier”, stellt der Beamte scharfsinnig fest. “Vor zwei Monaten.”
Ich nicke. Sage mit trockenem Mund: “Ja.” Ich mag den Zoll nicht, weil ich immer das Gefühl habe, dass da etwas vor sich geht, was ich nicht verstehe.
“Und im März!”
In seiner Stimme klingt Triumph mit, als hätte er ein verborgenes Muster entdeckt. Wieder nicke ich.
“Weshalb?”
“Ich wollte Freunde besuchen.”
“Wie lange werden Sie bleiben?”
“Eine Woche.”
“Sie fliegen nach Deutschland zurück?”
“Ja.”
Der Stempel, den er mir in den Pass drückt, erlaubt mir, sechs Monate zu bleiben. Er gibt mir den Pass mit einem Ausdruck auf dem Gesicht zurück, der mir sagen soll: “Wir wissen über Sie Bescheid, mein Freund”.
Fünf
Zurück in Berlin. Ein Straßencafé am Ende des Ku’damms an einem Sommerabend. Lynette und ich sitzen da, jeder mit einem Weißbier, und sehen zu, wie die Berliner von einem Spaßvogel in einem schäbigen grauen Anzug veralbert und erniedrigt werden.
Hinter dem Rücken eines vorüberkommenden Einheimischen nimmt er dessen Schritt auf, macht seinen Gang nach, die hängenden Schultern, ja sogar seinen Gesichtsausdruck. Das Café bricht in Gelächter aus, der Berliner sieht sich um, der Nachahmer tut ganz unbeteiligt, er ist nicht einmal erschrocken darüber, dass man ihm auf die Schliche gekommen ist. Mit einem toleranten Lächeln und einem Nicken, setzt der Berliner seinen Weg fort. Kein Gestikulieren, kein Schreien, keine Schimpfworte.
Ich beobachte, wie sich der Spaßvogel an ein Paar heranmacht, zwischen sie schlüpft und den Arm um die Frau legt. Da sie annimmt, dass es ihr Ehemann sei, lässt sie ihn gewähren, bis sie schließlich zur Seite schaut und entdeckt, dass ein Landstreicher sie anstrahlt. Wiederum: kein hysterischer Schrei, kein Zorn. Lediglich ein Lächeln und ein Kopfschütteln, während sie sich von ihm losmacht.
Sechs
Ein heißer Abend im August. Wir waren fast den ganzen Tag unterwegs und sind jetzt pflastermüde und wollen nur zu gern schnell nach Hause. Wir kaufen uns Eis, während wir auf den Bus warten.
Nicht lange, und es kommt einer. Wir steigen ein.
“Nein, nein, nein”, ruft der Busfahrer, und schüttelt abwehrend einen Finger. “Im Bus wird nicht gegessen.”
Verlegen steigen wir wieder aus, zwei verwirrte, grauhaarige Leute in den Vierzigern, die wie bestrafte Kinder auf dem Bürgersteig ausgesetzt worden sind.
Sieben
Gemeinsam mit einem imbongi – einem Preissänger der Xhosa – der zu Besuch ist, stehe ich irgendwo in Kreuzberg am Straßenrand und sehe mir einen Karneval an. Es ist sein erster Besuch in Europa. Er hat Jeans an und ein buntes Hemd wie Mandela, Sandalen und über der Schulter einen Fotoapparat. Und er hat eine hohe Kopfbedeckung aus Stachelschweinborsten auf und trägt einen geschnitzten Gehstock bei sich. Wir sind vom Umzug wie von den Zuschauern gleichermaßen fasziniert.
Plötzlich packt er mich am Arm.
“Sieh dir das an! Sieh mal da!” ruft er und zeigt auf einen kleinen Stamm Eingeborener – Frauen, Männer und Kinder – die auf uns zukommen. Sie bilden einen bunten Haufen in Kleidern aus der Hippiezeit – fließende Baumwolle und Lederwesten. Ein paar haben sich die Köpfe kahl rasiert und rot eingefärbt, andere tragen das Haar nach Art der Mohikaner, nur dass sie es grün färben. Ihre Arme sind tätowiert. In die Ohren und Nasen, durch Lippen und Augenbrauen haben sie sich Metallringe – ziemlich viele – gestochen. Ein Teil der metallenen Verzierungen ist von beachtlicher Größe.
“Davon muss ich ein Foto machen”, sagt mein Freund und nimmt den Fotoapparat von der Schulter. Im selben Augenblick entdeckt ihn einer der Stammesältesten, und auch ihm kommt der Gedanke, ein Foto zu machen. Er holt die Kamera hervor.
Ein Auslöser klickt: “zivilisiert”.
Ein Auslöser klickt: “primitiv”.
Published 11 June 2002
Original in English
Translated by
Thomas Brückner
Contributed by Wespennest © Wespennest
PDF/PRINTNewsletter
Subscribe to know what’s worth thinking about.