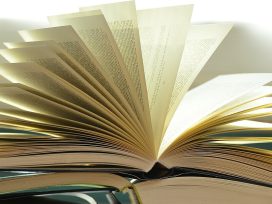
Growing reluctance to engage with books is endangering democracy and science. Deep reading boosts the human capacity for abstract and analytical thinking, protecting us from the corrosive effects of bias, prejudice and conspiracy theories.
In den vergangenen Jahren ist eine Reihe neuer Analysen zu den Gewaltkonflikten im Kaukasus erschienen. Nur den besten Studien gelingt es, die ethnonationalistischen Gewaltakteure konkret zu benennen, Spannungen zwischen offiziellen Geschichtsbildern und konkreten Erfahrungen aufzuzeigen und zu demonstrieren, wie sich die sowjetischen Muster der Feindbildproduktion bis heute fortsetzen. Föderalismus als Option der Konfliktregelung wird jedoch kaum diskutiert. Ein Forschungsdesiderat sind komparative Analysen zu den (semi-)autoritären Regimen im Kaukasus und ihren Reproduktionsmechanismen sowie zur Mikrodynamik von Konflikten und zu innergesellschaftlichen Konfigurationen. Auch eine vergleichende Politikfeldforschung, die die politische Ökonomie sowie die Funktionsweise gerade der parastaatlichen Gebilde in Bergkarabach, Abchasien und Südossetien in den Blick nimmt, steht noch aus.
Der Kaukasus wird in Mitteleuropa als exotische, ja orientalisch-mythisch aufgeladene Kreuzung von Europa, Asien und Mittlerem Osten wahrgenommen. Er ist mal terra incognita, mal zerklüftete Berglandschaft, mal Flickenteppich ethno-kultureller Vielfalt, dann Pufferzone oder umkämpfte Grenzregion, vor allem aber gilt er als Brennpunkt latenter und manifester Gewaltkonflikte. Kaum eine Darstellung zum Kaukasus beginnt, ohne eine dramatische Kulisse aufzubauen. Doch wer seit Jahren dieselbe Geisterbahn fährt, den werden die Gespenster antagonistischer “Identitäten” immer weniger erschrecken. Ein Haupteindruck von den Publikationen zum Kaukasus ist die rituelle Wiederholung der Konflikterzählungen. Die völkerrechtlich anerkannten Karten der südkaukasischen Entitäten widersprechen den mentalen Karten mindestens einer Konfliktpartei und der Geographie realer Macht. Alle Konfliktakteure scheinen dem Motto zu folgen “Am Anfang war das Wort” (mein Konfliktnarrativ!). Doch nicht jedes Wort ward Fleisch, manches nur Blut. Das Dilemma: Die Konfliktnarrative sind institutionalisiert, ihnen fehlt aber die institutionelle Anerkennung.
Der Kaukasus mit seinen etwa 50 indigenen Nationalitäten könnte als Beleg dafür gelten, dass ethnische Heterogenität, Sowjetföderalismus, bergige Landschaft und vitale Interessen externer Mächte einen fruchtbaren Boden für ethnische Konflikte abgeben. Jeder Referenzrahmen, jedes Etikett für den Kaukasus enthält so bereits eine These, ein Paradigma zur kognitiven Filterung von Geschehnissen. Wer von einer Grenzregion spricht, impliziert, dass Grenzen gezogen und umkämpft sein müssen. Wer die Last der Geschichte betont, betrachtet sie als Faktum, nicht als Ergebnis selektiver, manipulativer und kontingenter Erinnerungspraktiken. Die endemische Überdeterminierung durch Vergangenheit und strukturelle Heterogenität, die zahlreiche Studien zum Kaukasus auszeichnet, verdeckt jedoch mehr als sie erklärt, denn nicht die Geschichte macht Politik, sondern Akteure machen Politik mit ihr.
Die Konflikte um Bergkarabach, im Nordkaukasus (vor allem Dagestan, Tschetschenien), um Abchasien und Südossetien stehen im Schatten akuter Gewaltkonflikte um die Ukraine und im Nahen bzw. Mittleren Osten. Gleichwohl schwelt ein Unbehagen – könnte dort der nächste, möglicherweise vermeidbare Gewaltausbruch seinen Lauf nehmen? Allein für den Zeitraum einer Woche im August 2015 berichtete eine armenische Agentur über 900 Verletzungen des Waffenstillstandes in Bergkarabach durch aserbaidschanische Kräfte, die ihrerseits die Armenier beschuldigten. Wie häufig sind vermeintlich “eingefrorene” Konflikte erneut gewaltsam eskaliert? Nach dem Krieg in Georgien und der Ukraine ist es nicht unangemessen, den Eskalationspotentialen mehr als beiläufig Aufmerksamkeit zu widmen.
Was lehren uns die Publikationen über die “eingefrorenen” oder “schwelenden” Konflikte im Kaukasus über ihre Ursachen, Dynamiken und die Chancen zu ihrer Regelung? Die Kaukasuskonflikte haben alle ihre eigene Pathogenese. Sie sind miteinander verflochten, weisen gemeinsame Muster auf und zeichnen sich doch durch je eigene Voraussetzungen, Dynamiken, Gewaltintensitäten, externe Einflüsse und Handlungsoptionen aus.
Gemeinsam ist den Staaten, Gebietseinheiten und soziopolitischen Gemeinschaften, dass sie sich über Primärfeinde, den Einfluss externer Mächte und Gewalterfahrungen definieren. Politische Institutionen, die Regimelegitimität und die Managementkapazität sind schwach. Der öffentliche Raum ist in hohem Maße polarisiert, nach der Desintegration der Sowjetunion ist weder eine neue grenzüberschreitende Kommunikation noch ein ziviles, nicht ethnisch-exklusives Verständnis von Staatsbürgerschaft entstanden.
Die sozialwissenschaftliche Literatur zum Kaukasus lässt sich unterteilen in (1) ethnonationalistisch-parteiliche, methodisch meist schwache Publikationen, (2) geopolitische Abhandlungen zu den äußeren Einflussmächten (Great Game, EU-Nachbarschaftspolitik oder Russlands “imperiale” Politik), (3) Studien zu den Makro-Konfliktursachen (meist Staatsschwäche, Identitäten und ethnische Heterogenität), (4) historische Überblicksdarstellungen, (5) Darstellungen zu Wechselwirkungen zwischen politischen Regimen und Gesellschaft und schließlich (6) Publikationen, die Potentiale der Konfliktbearbeitung identifizieren wollen.
Die am weitesten gespannte Abhandlung unter den jüngeren Werken zum Kaukasus liefert James Forsyth, der die Zeit von der Antike bis zur Gegenwart abhandelt. Das opus magnum umfasst die Ethnogenese, die persischen, griechischen, römischen, arabischen, osmanischen und russisch-imperialen Einflüsse, die Abfolge von Dynastien, Verflechtungsgeschichten und politische Großereignisse, vor allem des 20. Jahrhunderts. Der Aufbau wechselt zwischen der Geschichte einzelner Völker, der Einflussnahme äußerer Mächte und summarischer Epochendarstellung. Es handelt sich nicht nur um eine Geschichte des Kaukasus, sondern auch um eine Geschichte der Beziehungen zum regionalen Umfeld. Forsyth, 1928 geboren und lange Hochschullehrer an der University of Aberdeen, hat sich durch seine Geschichte Sibiriens von 1992 einen Namen gemacht. Etwa ein Drittel des Buches behandelt die Zeit bis zum Ersten Weltkrieg, ein weiteres Drittel die Auflösung des Zarenreiches und die Sowjetzeit und das letzte Drittel die Entwicklungen von Anfang der 1990er Jahre bis 2008. Der frühgeschichtliche Part wird auf Grundlage antiker Aufzeichnungen – darunter des berühmten Geographen Strabo –, sowjetischer Darstellungen und bekannter Ländergeschichten rekonstruiert. Die Eroberung und Beherrschung Armeniens, Georgiens und des kaukasischen Albaniens (heutiges Süddagestan und Aserbaidschan) durch islamische Araber beschreibt Forsyth als Geschichte der Gewalt: Raub, Versklavung, Zwangsbesteuerung, Strafexpeditionen, permanente Konkurrenz mit Byzanz und Persien, Aufstände, wechselnde Loyalität der Vasallen, abgelöst durch die Eroberung weiter Teile des Kaukasus durch Seldschuken, Chasaren, Perser, turksprachige Zentralasiaten und Mongolen.
Die Frühgeschichte der Georgier, Armenier und Albaner, aber auch der skandinavisch-russischen Seefahrer, dient bis heute der Rückprojektion von Nationalgeschichten und entsprechenden Behauptungen eines historischen Primats. Forsyth erwehrt sich der national- ebenso wie der sowjetgeschichtlichen und der russozentrischen Imperative, indem er Verflechtungen und die Ethnogenese als evolutionäre Vermischung von autochthonen Siedlern, Eroberern und Migranten beschreibt. Die Rückdatierung von territorialen Ansprüchen ist insbesondere im aserbaidschanisch-armenischen Verhältnis von anhaltender Sprengkraft. Ebenso brisant ist der Konflikt zwischen osmanisch beeinflussten Sunniten und persisch-orientierten Schiiten – insbesondere innerhalb Aserbaidschans und aufgrund sunnitischer Kämpfer kaukasischen Ursprungs, die auf Seiten des IS kämpfen – sowie der Disput über die Freiwilligkeit der Treueschwüre nordkaukasischer Herrscher gegenüber den Zaren. Loyalitäten wechselten in Abhängigkeit von den Kräfteverhältnissen zwischen den benachbarten und konkurrierenden Großreichen.
Ende des 18. Jahrhunderts begann die imperiale Expansion des Zarenreichs in den Kaukasus, die mit Rassismus und Zwangsbekehrungen zur Orthodoxie einherging und einen hartnäckigen, rücksichtslosen, vom örtlichen sufistischen Islam inspirierten Widerstand insbesondere in Tschetschenien und Dagestan hervorrief. Der Krieg des Zarenreichs gegen die nordkaukasischen “Tscherkessen” erweiterte das Repertoire organisierter Gewalt um den Vernichtungskrieg, eine Vorläufergewalt, auf die nachfolgende Gewalttäter legitimatorisch zurückgriffen. Phänomenologische Ähnlichkeiten zur interethnischen Gewalt während und nach der Auflösung der Sowjetunion lassen sich in der Zeit von 1905 bis 1917 und während des Bürgerkrieges, insbesondere zwischen Armeniern und Aserbaidschanern, Georgiern und Abchasen sowie Georgiern und Armeniern finden. Doch sind es Räume begrenzter Staatlichkeit, in denen Gewaltunternehmer die Abgrenzung von Gemeinschaften und Autoritätsansprüche durchsetzen und dabei auf das Narrativ vom ewigen Hass zurückgreifen.
Forsyths chronologische Darstellung gewinnt nach dem Ersten Weltkrieg merklich an Tiefenschärfe. Er beschreibt die Hoffnungen der sozialrevolutionären oder menschewistischen Politiker aus dem Kaukasus auf einen Nationalstaat oder eine nationale Autonomie und den 1917 beginnenden Bürgerkrieg und zeichnet die vielfältigen Konflikte, die zur sukzessiven Machtübernahme der Bolschewiki führten, nach: Sie wurde ermöglicht durch interethnische Statuskonflikte, die Spaltung zwischen säkularen Revolutionären und islamischen Traditionalisten, zwischen demokratischer Mittelklasse und russischen Kommunisten, durch ethnische Antagonismen, schwankende Loyalitäten gegenüber den “Weißen”, den armenischen Glauben an russische Unterstützung, Landversprechen, Kooptation, kriminelle Gewalt, Uneinigkeit über die nationalen Aspirationen und die Konkurrenz externer Mächte (Türkei, Großbritannien, Persien, Deutschland). Die kundige Darstellung des stalinistischen Terrors, des Zweiten Weltkriegs, einschließlich deutscher Okkupation, der Kollaboration und von Stalins Deportationen basiert weitgehend auf einem älteren Forschungsstand, d.h. den Arbeiten von Robert Conquest, Alexander Dallin, Abdurachman Avtorchanov, Joachim Hoffmann und Audrey Altstadt. Der spät- und postsozialistische Aufstieg des Nationalismus wird von Forsyth auf die vorherige Repression, die Ablehnung des “imperialen Zentrums”, Missachtung durch die Sowjetführung, russische Arroganz und endemischen interethnischen Groll zurückgeführt – Erklärungen, die allzu selbstevident daherkommen, um wirklich zu überzeugen. Der wohlfeilen Vorstellung, erst die Stalinsche Politik habe die Kaukasusvölker auf unnatürliche Weise getrennt, erteilt Forsyth freilich eine klare Absage: Hohe Bergkämme haben verhindert, dass sich Ethnien in homogene Staatsvölker transformierten. Zugleich entstanden vielschichtige Verflechtungen. Prononciert bezieht Forsyth Position in seiner Darstellung der Tschetschenienkriege, besonders gegenüber notorischen Putin-Apologeten, namentlich gegenüber Richard Sakwa.
Will man Forsyths Werk einer Disziplin zuordnen, so wäre es am ehesten die historische Geographie. Es handelt sich um eine Art “Baedeker” – belesen, empirisch reich, übersichtlich, quellenkritisch und flüssig geschrieben. Forsyths Geschichte ist vor allem eine der Eroberungen, der Herrscher und Herrschaftstechniken und der Ethnogenese. Sein Zugriff ist konventionell, auf die Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, die Kultur oder den Alltag geht er nur gelegentlich ein. Einen eigenen interpretativen Ansatz entwickelt er nicht. Das Buch basiert auf einer Zusammenschau umfangreicher Sekundärliteratur, die Syntheseleistung ist eindrucksvoll. Es fehlt allerdings ein zusammenfassendes Fazit. Die verarbeitete Literatur ist zum Teil veraltet, insbesondere gilt dies für die spätsowjetische und die postsowjetische Periode. Bei Forsyth schlägt eine britisch-empiristische Tradition durch – man wünscht sich größere Linien, nicht nur Zahlen, Daten, Fakten. Es handelt sich jedoch zweifellos um ein grundlegendes Werk, das jedem Kaukasusinteressierten das nötige Hintergrundwissen vermittelt und insbesondere gegen nationalistische und apologetische Vereinnahmungen immunisiert.
Thomas de Waals Buch über den Karabach-Konflikt ist bereits in vielen Rezensionen als umsichtig, akribisch, ja brillant bezeichnet worden. Mehr als ein Jahrzehnt nach dem ersten Erscheinen ist es nach wie vor lesenswert, weil de Waal nicht nur eine detaillierte Konfliktchronik bietet und die Betroffenen auf beiden Seiten zu Wort kommen lässt, sondern vor allem weil er die strukturellen Konfliktdynamiken herausarbeitet. De Waal war lange Jahre Russland- und Kaukasus-Reporter für die BBC, Moscow Times, The Times of London und The Economist und gilt aufgrund seiner preisgekrönten Bücher, darunter ein Tschetschenienbuch mit Carlotta Gall, zu Recht als einer der Autoren mit der besten Kenntnis der Region. Seine journalistisch geschulte Beobachtungsgabe enthüllt mehr über den Südkaukasus als manche angestrengt theoretischen Dissertationen, die nur ihren längst gewählten “approach” bestätigen wollen oder sich auf das Sammeln von Fakten beschränken. De Waals Mischung aus Reportage und Reflexion hat die Qualitäten von Tocquevilles Reiseberichten aus Amerika. Er liefert eine komplexe Mikrogeschichte des Karabach-Konfliktes und verknüpft in einer immer dichter werdenden Collage Interviews, Alltagsbeobachtungen und Erinnerungsorte mit Auskünften und Beobachtungen zur hohen Politik und geschichtlichen Rückblicken. Der Abstand zu der massiven Gewalt zwischen 1987 und 1994 hilft, Distanz zu den vereinnahmenden Opferdiskursen zu wahren und hinter dem Leid Ursachen zu erkennen. Mahmood Mamdani nannte sein Buch über den Hutu-Tutsi-Konflikt When Victims Become Killers, und dies könnte auch als Motto über de Waals Bericht stehen: Armenier vertrieben und ermordeten Aserbaidschaner, Aserbaidschaner ermordeten und vertrieben Armenier. Die von Armenien unterstützten Bergkarabach-Armenier kontrollieren seither Gebiete in Aserbaidschan, und Armenien blockiert die aserbaidschanische Exklave Nachitschewan, während Aserbaidschan Armenien von Handelsrouten abschneidet. De Waals Buch über den Karabach-Konflikt könnte eine Katharsis unter Armeniern und Aserbaidschanern fördern. Doch gerade weil er den armenischen und aserbaidschanischen Nationalisten die Geschichte nicht überlässt, wird er von beiden geschmäht. Gewalt lebt nicht Erinnerungen aus, sondern will sie durch Eindeutigkeit auslöschen.
De Waal lässt Gewaltakteure und Gewaltopfer, Politiker, Interventen und Mediatoren zu Wort kommen. Auf diese Weise wechselt und verschränkt er immer wieder die Perspektiven. Wenn es eine Botschaft in seinem Buch gibt, dann dass Unsicherheit, Misstrauen und Gelegenheiten Gewalt gebären und Gewalt erst die Polarität der Identitäten hervorbringt, durch die sie sich anschließend selbst legitimiert. Nicht ewiger Hass oder sozioökonomische Disparitäten stehen hinter dem armenisch-aserbaidschanischen Konflikt. Nationalistische Leidenschaften verdrängten laut de Waal individuelle Erfahrungen von Koexistenz, Austausch und Freundschaft – präziser wäre es, von Kollektivnormen der Gewalt zu sprechen. Die Positionen verhärteten sich, weil beide Seiten von feindlichen Hintergrundmächten ausgehen: Armenien ist in der dominanten aserbaidschanischen Sicht ein Instrument des russischen Imperialismus, in Armenien gilt Aserbaidschan als Helfershelfer türkischer Expansion.
Die Eskalation des armenisch-aserbaidschanischen Konfliktes um die staatliche Zugehörigkeit Karabachs wurde durch bestimmte Rahmenbedingungen begünstigt: eine gegenüber ethnischen Konflikten ignorante, in Konfliktregelung ungeübte, zwischen Hardlinern und Partei-Internationalisten gespaltene sowjetische Zentralmacht, ethnisch getrennte Öffentlichkeiten, intellektuelle Propagandisten sowie Amtsinhaber, die den Verlust ihrer Macht fürchteten und daher opportunistisch agierten. Auf die Eskalation wirkten die üblichen Katalysatoren ein: erste Gewaltopfer, Meldungen über Vergewaltigungen, Gerüchte über bevorstehende Umsiedlungen, der Aktivismus von Diasporagruppen, eine inaktive oder mit Scharfmachern kollaborierende Polizei, rituelle Massenveranstaltungen, die eine Erwartungsrevolution auslösen, der leichte Zugang zu Waffen und die Radikalisierung von Flüchtlingen, die auf Revanche sinnen und dann auf eine altbekannte Institution zurückgreifen: das Pogrom. Lassen die Sicherheitsapparate die Täter gewähren, dann ist der Antagonismus fast unumkehrbar, fundamentale Existenzsangst lässt kaum noch Chancen auf eine Verständigung. Doch wandeln sich die pogromciki zu organisierten Paramilitärs, dann müssten staatliche Sicherheitskräfte zu einer massiven, opferreichen Aufstandsbekämpfung mit fraglichem Ausgang bereit sein, um jene wieder einzudämmen.
De facto ist Karabach seit fast 25 Jahren von Aserbaidschan abgetrennt, doch weder scheint eine Anerkennung des Status quo noch dessen Revision möglich, keine Seite möchte aus dem Friedensprozess mit einer Niederlage hervorgehen und keine Seite ist bereit, die eigene Bevölkerung auf einen Friedensschluss vorzubereiten, so Thomas de Waal. Der schwelende Konflikt nützt den autoritären Machthabern, ein Friedensprozess würde ihnen die Kontrolle der Bevölkerung erschweren, jede Kompromissbereitschaft setzt Politiker den propagandistischen und gewaltsamen Angriffen radikaler Nationalisten aus. Die vom Konflikt abhängige externe Unterstützung – durch Russlands Militär und die Diaspora zugunsten der armenischen, durch die Türkei und Iran zugunsten der aserbaidschanischen Seite – möchten beide nicht zur Disposition stellen. Beide Seiten haben sich so auf die Gesprächslosigkeit und eine Zukunft in Abgrenzung vom Gegner eingestellt. Der Konflikt ist folglich eingefroren und schwelend zugleich – ein militärischer und politischer Status quo zwischen Gewaltakteuren, der de facto, aber nicht de jure anerkannt ist, weil keine konfliktbeteiligte Partei ihn zu vertretbaren Kosten und Risiken fundamental revidieren kann, aus dessen Existenz aber eigene Legitimität hergeleitet wird. Die Hauptakteure sprechen sich wechselseitig die Legitimität ab, und daher fehlt eine wesentliche Voraussetzung für Diplomatie. Die Eskalationsgefahren werden von potentiellen externen Vermittlern wiederum als gering eingestuft und rufen somit kein nachhaltiges Engagement hervor. Die Demarkationslinien und die Identitätsbildung werden indes durch Gewalt oder deren Androhung periodisch aktualisiert, d.h. es gibt ein Wechselverhältnis von “Einfrieren” und gewaltsamem “Auftauen”, der Konflikt ist eingebettet in die Überlebensstrategien der Regime.
Liefern die Konflikte im Südkaukasus neue Erkenntnisse für die Konfliktforschung? Der an der London School of Economics arbeitende Kevork Oskanian schaut in seiner Dissertation mit den Prämissen der Theorie regionaler Sicherheitskomplexe auf die Region. Oskanians Studie ist theoretisch ambitioniert und im Kern darauf aus, das von Barry Buzan und le Wver entwickelte Konzept (“Kopenhagener Schule”) zu belegen. Die Schlüsselbegriffe lauten “Freundschaft vs. Feindschaft”, “Staatsschwäche” und “Durchdringung durch Großmächte”, vor allem aber “Versicherheitlichung”. Der Ansatz kombiniert klassische Konzepte des Neorealismus (Konfiguration internationaler Grenzen, Anarchie, Polarität, Gleichgewichtspolitik und Nullsummenspiele) mit der “sozialen Konstruktion” von “Versicherheitlichungen” (Oskanian, S. 9). Oskanian unterscheidet zwischen revisionistischen und status quo-orientierten “Konfliktformationen”, “dünnen” und “dicken” Sicherheitsregimen und “lockeren” und “engen Sicherheitsgemeinschaften”, die als Ideal-, nicht als Realtypen betrachtet werden und fließend ineinander übergehen. Aufgrund inkompatibler Identitäten und Werte unter den südkaukasischen Staaten hält Oskanian die Region für eine instabile “revisionistische” Konfliktformation und fragt nach Ansatzpunkten, um die Identitäten und Werte kompatibler machen zu können. Er bleibt seinem Ansatz mit beeindruckender Konsequenz treu. Multikausal verknüpft er materielle Bedingungen auf der innerstaatlichen und internationalen Ebene mit den vorherrschenden Sicherheitsdiskursen, bei denen er “argumentative” (wertebezogene) und instrumentelle unterscheidet.
Der Terminus “Versicherheitlichung” wird von Oskanian mit Clustern, Netzwerken, “sedimentierten” ideellen Strukturen und der Identifikation von existentiellen Bedrohungen umkreist, aber nie klar definiert und soll wohl zum Ausdruck bringen, dass Identitäten durch die Aufladung mit Sicherheits- und Überlebensinteressen einen Fundamentalcharakter gewinnen, dem sich kein Akteur entziehen kann. Die Hauptthese von Oskanian besagt, dass die Ursache für die Fundamentalisierung wechselseitiger Feindschaften in der Schwäche innerstaatlicher Legitimität zu finden ist sowie in “instrumentellen” Diskursen, die den Krieg als Mittel der Zielerreichung nie diskreditierten. Die “argumentative” Seite der “Versicherheitlichung”, d.h. die Feindbilder, sei so überwältigend, dass materielle Interessen und mögliche Kooperationsgewinne dem völlig untergeordnet würden. “Rationales Verhalten” sei kulturell eingebettet, folglich bezögen die Regime Legitimität nicht aus Rechtsstaatlichkeit oder materiellen Leistungen, sondern aus nationalistisch-mythologischen Zielen, die sie sich gesetzt haben. Die Regierungen verfügten über keine wirksamen politischen Mechanismen, aus denen sie ein Mandat für Kompromisslösungen beziehen könnten (S. 161). Die äußeren Großmächte wiederum hätten nur ein instrumentelles Interesse – Öl bzw. Einfluss – am Südkaukasus, würden aber als Vermittler weitgehend ausscheiden, weil keine äußere Macht unilateral Bedingungen diktieren könne noch ein Konzert der Großmächte, infolge divergierender Präferenzen und Allianzen, wahrscheinlich sei.
Die Konflikte im Südkaukasus erscheinen bei Oskanian als geradezu tiefgefroren, Ansätze zur Veränderung des Status quo erkennt er trotz mühseliger Suche nicht. Gleichwohl hängt er am Begriff der “revisionistischen, instabilen” Konfliktformation – der Befund ist widersprüchlich, denn Stabilität des Status quo und Revisionismus widersprechen sich.
Oskanians Analyse überzeugt bei der Darstellung der Funktionalität der Konflikte für den Erhalt der autoritären Regime und als Bedingung äußeren Einflusses, insbesondere im Falle Russlands. Und doch befriedigt die Erklärung nicht, und zwar nicht, weil sie Erwartungen von Friedensfreunden enttäuscht, sondern weil sie am Konzept der “Versicherheitlichung” klebt und die Identitätssicherheit kraft kulturalistischer Ausgrenzung ethnisch anderer Gruppen zur letztlich entscheidenden Urkraft überhöht. Ob die “Versicherheitlichungen” von oben, d.h. jene offiziellen Sprechakte, die existentielle Bedrohungen beschwören und zugleich Notstandspolitik rechtfertigen sollen, tatsächlich kollektiv und bruchlos geteilt werden, ist fraglich und wird maßgeblich von den Massenmedien, den intellektuellen Vermittlern und den Kontrollinstanzen über gesellschaftliche Kohäsion und Legitimationsbeschaffung beeinflusst. Schließlich ist die Bemühung von Sicherheitsinteressen zwischen den Konfliktparteien nicht symmetrisch verteilt – den einen geht es um “Gerechtigkeit”, den anderen um Souveränität. Sicherheit ist nur für die Bergkarabach-Armenier, die Abchasen und die Südosseten ein Leitmotiv.
Emil Souleimanov, Hochschullehrer an der Prager Karls-Universität, setzt sich kritisch mit gängigen quantitativen Ansätzen und soziologischen Großtheorien über ethnopolitische Konflikte auseinander, um die Lücke zwischen Makroerklärungen und Konfliktverhalten auf der Mikroebene zu füllen. Kundig diskutiert Souleimanov die gängigen primordialistischen, makrostrukturellen (Interessen, Identität, Konfliktressourcen, Demographie, Geographie, Regimetyp, Ungleichheit) und politisch-instrumentalistischen Konzepte ethnopolitischer Konflikte, um ihre Erklärungsreichweite zu bestimmen. In Anlehnung an David Dessler macht Souleimanov dann die Begriffe “Kanäle” (Hintergrundbedingungen), “Ziele” (Mobilisierungsstrategien), “Auslöser” und “Katalysatoren” für die Analyse der Eskalation von sporadischer zu umfassender Gewalt fruchtbar. Souleimanov unterscheidet zwischen Mobilisierung, Radikalisierung und anhaltender großer Gewalt in Bürgerkriegen. Der Eigendynamik und begrenzten Steuerbarkeit von organisierter Gewalt, auf die schon von Clausewitz hingewiesen hatte, wird damit anstelle statischer Konzepte – etwa dem der “Versicherheitlichung” – Rechnung getragen. Im Unterschied zu der auf Strukturen bzw. Hintergrundbedingungen fixierten Literatur zu Konfliktursachen interessiert Souleimanov die Konfliktdynamik. Um Gruppenkohäsion und Kollektivhandeln zu befördern, würden politische Führer auf Hassreden, manipulierte existentielle Rhetorik und Aussichten auf nationale Auslöschung, d.h. Angst und Verdacht, zurückgreifen. Gewalteskalation werde, so Souleimanov, entweder durch zunehmende staatliche Repression, durch generelle staatliche Unfähigkeit oder durch die staatliche Ineffektivität befördert. Die Wahrnehmung relativer Machtasymmetrien zugunsten der eigenen Partei schaffe Anreize, aber erst die bewusste Entscheidung zu “konzentriertem kollektiven Handeln” zur Erreichung spezifischer politischer Ziele führe zum Bürgerkrieg (Souleimanov, S. 48f.).
Souleimanov begibt sich auf die für Autoren zum Kaukasus anscheinend unvermeidlich lange Reise in die Geschichte der “Identitäten” von Armeniern und Aserbaidschanern, von Abchasen, Südosseten und Georgiern, um die These vom tiefverwurzelten ethnischen Antagonismus, von Traumata und Tragödien zu belegen. Am Beispiel Aserbaidschans illustriert er dann freilich detailliert, dass Clans, regionale Machtzentren und politische Nahkämpfe die spät- und postsowjetische Periode prägten. Auch in Armenien erhielt die Pan-Armenische Nationalbewegung bei den ersten mehr oder minder freien Parlamentswahlen (1990) nur ein Drittel der Stimmen. Die nationalistische Bewegung unter Zviad Gamsakhurdia in Georgien errang zwar im selben Jahr 53 Prozent der Stimmen bei den Parlamentswahlen und bei den Präsidentschaftswahlen dann 86 Prozent, doch gehörten bewaffnete Milizen und kriminelle Gangs, die rabiate Denunziation von Kritikern als Agenten Moskaus und der Wahlboykott der Südosseten und Abchasen zum Kontext der nationalen “Identitätsbildung”.
Vor dem Hintergrund des sozio-ökonomischen Niedergangs in der späten Sowjetunion, der Tabuisierung der Erinnerung an vergangene Gewalt und Zweifeln an der Solidarität der Volksgenossen reaktivierten Philologen, Historiker und Sowjetdissidenten verschüttete Ängste, die von den drastischen Erzählungen befeuert werden, die Überlebende von Vertreibungen und Pogromen mitbringen. Folge ist, dass jede Konfliktpartei sich als autochthon und existentiell bedroht darstellt, um ihren Territorialansprüchen einen fundamentalen Status zu verleihen – etwa als letzter Vorposten des Christentums (Armenier) gegen türkische Barbaren (Aserbaidschaner).
Souleimanov zeichnet, ähnlich wie de Waal, die Verflechtungsgeschichte der Gewalt zwischen Armeniern und Aserbaidschanern, zwischen Georgiern und Abchasen bzw. Südosseten mit konturierten Strichen nach, vor allem dokumentiert er die Etappen der Eskalation – von der Mobilisierung für “historische” Anrechte über die Radikalisierung durch sporadische, gleichwohl organisierte Gewalt – meist mit dem Ziel der Vertreibung – bis hin zum Bürgerkrieg.
Souleimanov zieht vielfach Parallelen zur Gewalt während der Jahre 1918-21. Doch warum sollten junge Männer 70 Jahre später für ihre Großeltern Rache üben? Ohne interessierte Vermittler würde aus alter Gewalt kein akutes Motiv. Angst kann nur geschürt werden, wenn es gelingt, die alten Geschichten in antizipierte Zukunft zu verwandeln. Souleimanov diskutiert diese Übersetzung jedoch nicht.
So schleichen sich beim klugen und umsichtigen Souleimanov leider hin und wieder Stereotypen ein – etwa die Rede vom ideologischen Vakuum, von “tragischen Ereignissen”, von “Identitäten” und von der nationalen “Emanzipation”. Souleimanov diskutiert abschließend den spezifischen Einfluss struktureller Konfliktursachen, d.h. von Ressourcen, der Diaspora und der Geographie, der Demographie und des Regimewechsels, die sozio-ökonomische Privilegierung der eigenen ethnischen Gruppe und den Effekt von Sicherheitsdilemmata. Der “ewige Hass” sei mehr Resultat als Ursache der Gewaltkonflikte. Der sowjetische ethnoterritoriale Föderalismus verursachte für sich genommen mitnichten sezessionistische Gewalt. Die Institutionalisierung von Gewalt bis hin zum Bürgerkrieg basierte auf der Verfügung über zuvor zentralstaatlich kontrollierte Ressourcen nach der Auflösung der Sowjetunion. Für ausschlaggebend hält Souleimanov die Interaktion von altkommunistischen Parteieliten mit den nationalistischen Herausforderern und deren Gruppenkohäsion. Souleimanovs Buch ragt heraus durch die systematische und kritische Diskussion der theoretischen Korrelationen von Gewalt, es identifiziert Eskalationsmuster, ist durchweg komparativ und konzise geschrieben.
Ismail Küpelis Broschüre (2013), der Sammelband von Shelley, Scott und Latta (2007) und die Studie von Florian Mühlfried (2014) gehören zu den wenigen Arbeiten, die die Betriebsweise der politischen Regime und das Verhältnis von Staat und Gesellschaft im Südkaukasus thematisieren. Küpeli, laut eigener Webseite “Politikwissenschaftler, Aktivist und freier Autor” greift in seiner knappen Untersuchung den Ansatz des Rentierstaates auf, um nach der Stabilisierung autoritärer Regime am Beispiel Aserbaidschans zu fragen. Zu den autoritären Stabilisierungsstrategien zählt er Zwang, traditionelle und informelle Institutionen, formelle und demokratische Institutionen sowie Patronage, Klientelismus und Rentierstaatlichkeit. Der Autor operiert mit einem Rentenbegriff, der sich weitgehend unhinterfragt an Anton Pawelkas Definition und an Benjamin Smith anlehnt und keine eigenständige Präzisierung für den aserbaidschanischen Fall vornimmt. Im Kern handelt es sich laut Küpeli um Rohstoffeinkünfte ohne direkte ökonomische Gegenleistung und beim “Rentierstaat” um eine Generierung von Einkünften, die nicht primär über Steuern, sondern Renten erzielt werden und den Staat autonom gegenüber seinen Staatsbürgern macht (Küpeli, S. 16). Freilich stammen Rohstoffrenten nicht nur von externen Akteuren (z.B. internationalen Öl-Konzernen), zudem werden Produktionsfaktoren, entgegen Küpelis Behauptung, durchaus eingesetzt – freilich mit Überschüssen, die sich aus Knappheitslagen bzw. Monopolstellungen ergeben. Schließlich belegt die Verwendung von Renten für klientelistische Regimeunterstützung (anstelle nur privater Aneignung), dass der “Rentenstaat” durchaus auf materielle Inkorporationsanreize angewiesen ist. Am Beispiel der Verteilung von Einkünften aus dem “State Oil Fund of the Republic of Azerbaijan” beobachtet Küpeli, dass Mittel mal für Flüchtlinge aus der Bergkarabach-Region, mal für den Bau einer Pipeline, dann für die Trinkwasserversorgung oder dann (z.B. in 2008) zu 88,5 Prozent unmittelbar in den Staatshaushalt flossen. Küpeli schließt daraus, dass Renten zwar temporär an Regimeunterstützer verteilt werden, doch hohe Renten nicht zwingend mit einem “umfassenden Rentierstaat” – gemeint ist Patronage und Klientelismus – einhergehen. Kurzum, die geläufige These vom “Rentenstaat”, der sich Loyalität durch selektive Umverteilung kauft, steht zumindest im aserbaidschanischen Fall auf wackeligen Füßen. Küpeli identifiziert damit ein relevantes Forschungsdesiderat: Die Frage nach dem Einfluss verfügbarer Renten auf die Verteilungsmuster bedarf systematischer Untersuchung.
Der Sammelband von Louise Shelley, Erik R. Scott und Anthony Latta, der aus einem Kaukasusprojekt des Terrorism, Transnational Crime and Corruption Center an der George Mason University, Washington, hervorgegangen ist, widmet sich der Korruption in Georgien und der Bilanz ihrer Bekämpfung unter Präsident Mikheil Saakashvili. Als Ursachen von Korruption erkennen die Autoren des Bandes endemische nepotistische Traditionen in der Gesellschaft, die prominente Stellung georgischer Händler in der sowjetischen Schattenökonomie und eine postsowjetische Gesetzlosigkeit insbesondere in den Sezessionsgebieten. Korruptionsbekämpfung habe unter Präsident Shevardnadze (1995-2003) nicht funktioniert, da sie als Mittel zur Bekämpfung politischer Gegner eingesetzt worden sei. Unter Saakashvili habe die Korruptionsbekämpfung bei der Polizei, der Steuererhebung, der Einschränkung von Doppelverwaltungen für Haushaltsmittel, die der Verschleierung von Ausgaben dienen, bei den Banken und im Energiesektor Fortschritte gemacht. Zahlreiche Oligarchen wurden verhaftet, ihr Eigentum eingezogen. Die Justiz und das Transportwesen blieben jedoch weitgehend unberührt, die Regulierung der Wirtschaft intransparent, bei Privatisierungen und bei der Personalrekrutierung (Ausnahme: Verkehrspolizei) spielte Vetternwirtschaft weiter eine große Rolle. Organisierte Kriminalität und Politik blieben auch drei Jahre nach Saakashvilis Amtsantritt Anfang 2004 eng miteinander verquickt, was sich insbesondere beim Schmuggel und der Geldwäsche gezeigt habe. Auf die Revolution der Erwartungen von 2003 sei eine Desillusionierung gefolgt.
Die empirisch unterfütterten Beiträge des Sammelbandes illustrieren den scharfen Kontrast zwischen nationalistischen Meistererzählungen, die nationale Einheit beschwören, und den nepotistischen und korrupten Praktiken, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Legitimität des politischen Systems unterminieren.
Florian Mühlfried widmet sich ebenfalls dem Beziehungsgeflecht zwischen Staat und Gesellschaft. Als Anthropologe hat er ein Jahr im ostgeorgischen Tuschetien verbracht, um die Interaktion der örtlichen Wanderarbeiter mit dem georgischen Staat und ihr Verständnis und ihre Praxis von Staatsbürgerschaft zu verstehen. Eine neoliberale Ökonomie sowie ein interventionistischer Staat gefährdeten die überkommene Lebensweise der Tuschen, in ihren Alltagspraktiken und rituellen Handlungen bewahrten sie sich jedoch reservierte Domänen und autonome Anpassungsstrategien; sie verhalten sich, so Mühlfried, skeptisch bis distanziert gegenüber dem Staat und seinen Identitätsangeboten. Erfahrene, gelebte Staatsbürgerschaft sei flexibel – mal identifiziert man sich mit dem Staat und partizipiert, mal zieht man Grenzen. Mühlfrieds Studie operiert mit dem schillernden Großkonzept der “Staatsbürgerschaft”, ohne deren verschiedene Dimensionen systematisch zu analysieren. Die zentrale Botschaft ist einleuchtend, aber wenig überraschend: Staat, Gesellschaft und Gemeinschaft sind in praxi mitnichten integral oder deckungsgleich.
Ungleich schwieriger als in Georgien ist unabhängige Forschung im Nordkaukasus. Umso begrüßenswerter ist das als Dissertation an der Oxford University verfasste, der politischen Geographie zuzuordnende Werk von Andrew Foxall, der in den Jahren 2008-2009 zur Untersuchung der ethnischen Beziehungen im Bezirk Stavropol’ Feldforschung betrieben hat. Insbesondere hat Foxall Interviews mit Angehörigen der regionalen Eliten sowie mit Nicht-Eliten (Studenten, Arbeiter, Pensionäre und Arbeitslose) durchgeführt. Nach einem historischen, sozio-ökonomischen und politisch-administrativen Porträt der Region vor und nach 1991 analysiert Foxall die ethnische Diskriminierung, Segregation und Gewalt im Bezirk Stavropol’, ethnische Pogrome, die “symbolische Landschaft” der offiziellen Geschichtspolitik und die Rolle föderaler und regionaler Organe beim Konfliktmanagement. Foxall interessiert sich für Interaktionen, ohne nach ethnischer Zugehörigkeit zu fragen, er konnte so die mannigfachen Orte und Grade der Erfahrung von Ethnizität dynamisch erfassen, ohne den Respondenten ein Konzept von Ethnizität vorzugeben.
Der Bezirk Stavropol’ ist Ziel zahlreicher Migranten aus dem Nordkaukasus, der Bevölkerungsanteil von Nicht-Russen hat sich seit 1989 verdoppelt. Der Anteil der Russen an der Bevölkerung sinkt seit 1989 kontinuierlich, wenn auch nicht dramatisch (von 84 Prozent auf 81 Prozent). Unter den ethnischen Russen sind rassistische bis neonazistische Stimmungen weit verbreitet, immer wieder kommt es zu Pogromen, insbesondere gegen Tschetschenen. Politisch fordern viele Russen eine Herauslösung des Bezirks Stavropol’ aus dem Föderalen Bezirk Nordkaukasus, um sich von den Nordkaukasiern abzusetzen. Die Bezirksverwaltung erkennt die Spannungen auf dem Arbeitsmarkt, im Bildungswesen und die Rückständigkeit ländlicher Gebiete zwar rhetorisch an. Sie leugnet nicht, dass Nicht-Russen beim Zugang zu Dienstleistungen, im Transportwesen und auf dem Wohnungsmarkt diskriminiert werden (Foxall, S. 146). Doch statt diese Probleme anzugehen, beschwört sie harmonische interethnische Beziehungen und betreibt eine Politik der “Versicherheitlichung”, schränkt also Bürger- und Minderheitenrechte systematisch ein.
Ungeachtet der beiden Tschetschenienkriege und der wirtschaftlichen Subventionierung des Nordkaukasus aus dem Moskauer Zentrum nimmt die Kluft zwischen Russlands Kernland und seiner südlichen Peripherie zu. Transparente föderale Transferleistungen, eine klare Migrationspolitik und die soziale Integration von Migranten wären für eine Entschärfung der schwelenden Konflikte vonnöten. Optimistisch ist Foxall nicht, er hält die Lage im Bezirk Stavropol’ zu Recht für exemplarisch: Überall in Russland nimmt die soziale Kohäsion ab, die “Russland den Russen”-Haltung und die Xenophobie gegen Kaukasier haben dramatisch zugenommen.
Die EU nährt mit ihrer Assoziierungspolitik bisweilen Hoffnungen auf Überwindung der Desintegration im Südkaukasus. Allerdings ist sie mehr Projektionsfläche denn gewichtiger Akteur. Was leistet die EU? Nurlan Hasanov hat bei den Rechtswissenschaftlern an der Universität Bremen eine knappe Dissertation vorgelegt, die sich der europäischen Nachbarschaftspolitik am Beispiel Aserbaidschans widmet. Nach einem Hintergrundkapitel zur Entwicklung des Landes seit der Unabhängigkeit und zur Verfassung geht Hasanov auf den mangelnden Wettbewerb, die Korruption, die wachsende Einkommensschere und die schleppende Reform des Justizwesens sowie der Finanz- und Steuerverwaltung ein. Die EU konzentriert sich auf den Beitritt Aserbaidschans zur Welthandelsorganisation, die Diversifizierung der Wirtschaft, den freien Außenhandel, die Übertragung der einschlägigen EU-Standards, den Abbau von Handelshemmnissen und auf die Umsetzung der EU-Energiecharta. 99,5 Prozent der EU-Einfuhren aus Aserbaidschan bestanden 2011 aus Öl- und Brennstoffen, und dies scheint die Prioritäten der EU zu bestimmen. Hasanov referiert und paraphrasiert die einschlägigen Dokumente der EU und Aserbaidschans. Die Analyse der Umsetzung der deklarativen in praktische Politik ist jedoch nicht Gegenstand der Arbeit. Daher dokumentiert die Abhandlung lediglich die Reformrhetorik, ohne nach der realen Gestaltungsmacht zu fragen.
Der Sammelband von Michail Kambeck und Sargis Ghazaryan will Möglichkeiten eines Friedensprozesses in Karabach und insbesondere die Rolle der EU erkunden. Zwei Fragen ziehen sich durch den Band: Wie kann erreicht werden, dass die Kriegsparteien sich an den seit 1994 geltenden, aber in den letzten Jahren immer brüchigeren Waffenstillstand halten und wie kann ein grenzüberschreitender zivilgesellschaftlicher Dialog initiiert werden. Uwe Halbach sieht einen möglichen ersten Schritt für eine “Roadmap” zum Frieden im Abzug armenischer Truppen von besetzten aserbaidschanischen Gebieten jenseits von Karabach und in internationalen Sicherheitsgarantien (S. 59). Doch wer sollte sich dafür verantwortlich fühlen? Die OSZE, deren Vermittlungsmissionen seit 23 Jahren daran scheitern, dass jede Seite Vorleistungen verlangt, ohne substantielle Angebote zu machen? Frieden kann nicht vermittelt werden, wenn die verfeindeten Seiten den Status quo vorziehen. Die EU, so Elmar Brok und Charles Tannock in ihren Beiträgen, agiere mitnichten aktiv (S. 111, S. 191). Verhandlungen zwischen den Parteien werden der OSZE überlassen, die keine Regelungsfortschritte vermelden kann.
Pogosyan und Martisoyan berichten von Bürgerversammlungen, die NGOs in Armenien, Aserbaidschan und Karabach organisiert haben. Die Angaben zu den Teilnehmern sind allerdings pauschal, und die Autoren vermischen ihre Beobachtungen immer wieder mit ihrer Meinung. Den Teilnehmern dieser Bürgerversammlungen gilt die EU als wirtschaftlicher Riese und politischer Zwerg, als humanitärer Akteur und Geldgeber. Für sie gelte Öl mehr als Sicherheit. Die Meinungen, die bei den Bürgerversammlungen geäußert werden, sind auf armenischer und aserbaidschanischer Seite oft sehr ähnlich. Peacekeeper, eine demilitarisierte Zone und die Unabhängigkeit Bergkarabachs werden von beiden Seiten überwiegend zurückgewiesen. Die Region sei Objekt von Großmachtinteressen, wird von den Meetings berichtet. Verantwortung wird also externalisiert. Als Alternative zum Status quo kommt den meisten nur Krieg in den Sinn. Vertrauen sei zwar nötig, aber nur nach Vorleistungen der Gegenseite möglich. Man mag sich fragen, ob öffentliche “Town Hall Meetings” mit ihren Gruppenzwängen ein angemessenes Setting sind, um Widerspruch und Zweifel zu äußern und selbstkritisch zu reflektieren. Es entsteht jedenfalls das Bild eines Konfliktes, aus dessen Frontstellung die Gegner fortwährend politischen Gewinn für die Regimelegitimation und das kollektive Ego ziehen. Die ethnonationalistischen Politiker, Gewaltakteure und intellektuellen Ethno-Propagandisten saugen aus dem Status quo ihre andernfalls höchst prekäre Legitimation als Herrscher.
Unter den 21 Beiträgen des Bandes von Kambeck und Ghazaryan findet sich nur einer aus aserbaidschanischer Feder. Die meisten Autoren des Bandes neigen implizit oder explizit armenischen Interpretationen zu, angefangen von einem chronologischen Abriss, der Armenier nur als Opfer und Selbstverteidiger vorführt, die aserbaidschanischen Opfer aber anzweifelt, übergeht oder die Täter nicht erwähnt. Armenische Eroberungen gelten nur als Schutz vor ethnischer Säuberung. Behauptet wird in der Ereignischronologie z.B., 2500 islamistische Söldner hätten ab 1993 auf aserbaidschanischer Seite gegen Bergkarabach gekämpft. Die Washington Post schätzte seinerzeit (auf der Grundlage von vagen diplomatischen Quellen), dass 1000-1500 Afghanen an einer Militäroperation auf aserbaidschanischem Territorium (Zangilan Region) gegen armenische Kämpfer teilnahmen. Infolge der Überlegenheit des armenischen Militärs wurden dann allerdings ca. 60 000 Aserbaidschaner durch armenische Truppen vertrieben – die Chronologie von Kambeck und Ghazaryan erwähnt die “Islamisten”, nicht aber die Vertreibung und wird damit selbst zum Dokument einer manipulativen Erinnerungspolitik. Seit Jahrzehnten fordern Armenier die Anerkennung der von Türken und Kurden zu verantwortenden Massendeportationen und des Massenmordes von 1915 sowie der Pogrome von Sumgait und Baku. Die armenische Opferidentität würde freilich ihre Exklusivität einbüßen, wenn die Vertreibung und der Mord an aserbaidschanischen Zivilisten durch armenische Militärs anerkannt würden. Die armenische Erklärung zu aserbaidschanischen Opfern ähnelt verblüffend der offiziellen türkischen Darstellung der Massenverbrechen von 1915: Kriegsfolgen, heißt es dann lapidar.
Die Emphase, mit der die meisten Autoren im Sammelband von Kambeck und Ghazaryan eine aktive Rolle der EU anmahnen, steht im Kontrast zu nüchternen Einschätzungen, etwa des EP-Abgeordneten Elmar Brok, der bereits als Erfolg verbucht, wenn die EU sich “betroffen” zeigt. Basierend auf den Vorschlägen von Otto Luchterhandt, Uwe Halbach, Sergej Markedonov, Tevan Pogoshsyan und Dennis Sammut plädiert Michael Kambeck im Fazit des Bandes dafür, Obstruktionen des Verhandlungsprozesses öffentlich anzuprangern, vertrauensbildende Maßnahmen zu implementieren, den Waffenstillstand vertraglich zu konsolidieren und ein umfassendes Waffenembargo zu verhängen – letzteres würde vor allem russische Waffenlieferungen treffen. Ein Embargo gilt als probates Mittel, ebenso Reisebeschränkungen für “Friedensstörer” und das Einfrieren ihrer Auslandskonten. Die EU solle ihre Neutralität preisgeben und Anreize im Rahmen der Assoziierungsabkommen mit Restriktionen verbinden. Freilich wurde das Assoziierungs- und Freihandelsabkommen mit Armenien nach russischer Einflussnahme und der armenischen Ankündigung, der Eurasischen Zollunion beizutreten, nicht mehr unterzeichnet – dieser Hebel der EU fällt also mittlerweile weg. Die Verhandlungen mit Aserbaidschan sind wiederum noch nicht reif für einen Abschluss.
Für einen Platz der EU in der Minsk-Gruppe der OSZE (Frankreich, Russland, USA, Armenien, Aserbaidschan) plädiert Kambeck nicht. Die EU würde, so Kambeck, die für die Präsidenten der drei externen Mächte eher unbedeutenden Verhandlungen nur noch komplizierter machen. Aus eigener Kraft kann die EU offenkundig keinen Konflikt managen, geschweige denn regeln, sofern nicht machtvolle nationale Regierungen die Führung übernehmen.
In dem Konferenzband von Ghia Nodia und Christoph Stefesvon 2015 werden die strategischen Interessen der südkaukasischen Staaten und der externen Mächte insbesondere im Bereich der Energiepolitik vertieft behandelt. Die übrigen, recht kurzen Fallstudien zu Einzelaspekten der Innen- und Identitätspolitik, zur externen Demokratieförderung und den De-facto-Staaten sind in den disparaten Band mit 18 Einzelbeiträgen nur buchbinderisch integriert. Nodia und Stefes halten die transformativen Anreize der EU-Nachbarschaftspolitik für gering, d.h. deren Hebelwirkung und Einflussnahme durch Verkopplungen. Grund: die fehlende Aussicht auf EU-Mitgliedschaft. Eine mögliche Interessengemeinschaft erkennen Nodia und Stefes zwischen Aserbaidschan, Georgien, der Türkei, den USA und der EU, und zwar aufgrund der Öl- und Gaspipelines. Die EU, so Sybilla Wege in demselben Band, agiere trotz erklärter Absicht, die Abhängigkeit von Russland durch Diversifizierung der Öl- und Gaslieferungen zu überwinden, inkonsistent: EU-Mitglieder verhandelten bilateral, der “Südliche Korridor” sei bisher ein Fehlschlag und alternative Pipelines von kommerziellen Interessen der Investoren, jedoch keiner politischen Vision getrieben (S. 298f.). Oana Poian identifiziert ein Nullsummenspiel zwischen Russland und der EU im Schwarzen Meer: Die Schwarzmeeranrainer kooperierten zwar bilateral, aber eine regionale Kooperation hätte die Annäherung zwischen Russland und der EU zur Voraussetzung (S. 326f.).
Esmira Jafarova widmet sich der Vermittlerrolle der Vereinten Nationen und der OSZE im Südkaukasus (bis zur Schließung dieser Missionen 2009, d.h. nach dem Georgienkrieg). Die Machtlosigkeit der OSZE sei Folge von Russlands Bemühen, die südkaukasischen Staaten in Abhängigkeit zu halten sowie von Moskaus Hang, den “Friedensprozess” zu dominieren – eine wohlfeile, reichlich unterkomplexe Erkenntnis. Die westlichen Staaten der Minsk-Gruppe der OSZE (Karabach-Konflikt) wiederum wollten Russland nicht vergraulen (S. 64f). Die Politik der USA charakterisiert Jafarova als inkonsistent und aufgrund des Einflusses der armenischen Diaspora als mitnichten unparteiisch (S. 116), die EU beschränke sich auf rhetorische Unterstützung für die Minsk-Gruppe der OSZE. Parteilichkeit, dominante Eigeninteressen oder Desinteresse externer Akteure sowie Formate, die das Erzwingen von Kompromissen (“power mediation”) ausschließen, münden in eine diplomatische Verwaltung des Elends.
Nach einer bündigen und übersichtlichen Einführung in Historie und Akteure des Karabach-Konflikts, einschließlich eines umfangreichen Anhangs mit OSZE-Dokumenten, widmet sich auch Aser Babajew der Politik der EU. Brüssel sei doppelzüngig, wenn es Georgiens territoriale Integrität verteidige, im Aktionsplan der Europäischen Nachbarschaftspolitik mit Aserbaidschan aber nicht auf die Achtung der Souveränität und territorialen Integrität verweise und sich damit auf die armenische Seite schlage (S. 115). Eine Wiedereingliederung Karabachs in den aserbaidschanischen Staat rücke ohnehin in immer weitere Ferne. Babajew plädiert dafür, dass die EU versuchen solle, Armenien mit ökonomischen Anreizen zu Kompromissen zu bewegen. Auch solle Brüssel mäßigenden Einfluss auf die armenische Diaspora ausüben und schließlich solle die EU Abchasien und Südossetien anerkennen (S. 138). Wie letzteres positiv auf den Karabach-Konflikt zurückwirken soll, verrät Babajew nicht.
Wohlmeinend plädiert er für einen armenischen Rückzug aus okkupierten Territorien jenseits von Karabach und einen aserbaidschanischen Gewaltverzicht im Gegenzug, für die Rückkehr von Flüchtlingen unter internationalem Schutz und die sukzessive Wiederbelebung wirtschaftlicher Kontakte (S. 142). Die meisten Politikempfehlungen muten ähnlich realistisch an wie Aufforderungen an Israel, sich auf die Grenze vor dem Sechs-Tage-Krieg zurückzuziehen. Nach Kriegen gibt es keine Rückkehr zum Status quo ante. Und wie viel Kalten Krieges bedurfte es, bis die Ostverträge wenigstens humanitäre Erleichterungen ab den 1970er Jahren ermöglichten? De Waal setzt seine spärlichen Hoffnungen auf zwischenmenschliche Kontakte, Stimmen aus der Zivilgesellschaft und das historische Gegennarrativ armenisch-aserbaidschanischen Zusammenlebens. Was er selbst vorführt, nämlich ein Doppelnarrativ, wäre Voraussetzung für einen Dialog – die Anerkennung und die Bereitschaft zum Anhören der leiddurchtränkten Meistererzählung der Gegenseite. Wenn die These vom regimestabilisierenden Einfluss “eingefrorener” Konflikte stimmt, dann würde erst ein Regimewandel, der zur Pluralisierung innerer Präferenzen führt, Bewegung in die erstarrten Konflikte bringen.
Keine analytische Perspektive ist unschuldig, dies gilt namentlich für den Fokus auf Identitäten, Nationen und Ethnien: Wer danach sucht, wird sie finden und damit zur Essentialisierung dieser Kategorien beitragen, also das Objekt der Untersuchung selbst konstruieren und so die Forschungsergebnisse vorherbestimmen. Dieser konstruktivistische Vorbehalt gilt für die meisten Studien zum Kaukasus mit ihrem Fokus auf historisierende und legitimierende Elitendiskurse. Ambivalenzen, kontingente Erinnerungspraktiken und eklatante Spannungen zwischen offiziellen Meistererzählungen und erfahrenen Lebenswelten werden vielfach bereits durch die Wahl der Untersuchungskategorien ausgeblendet. Ethnische Vermischung und Kooperation werden dann meist randständig abgehandelt. Vor allem aber bleiben die ethnonationalistischen Gewaltakteure ohne Gesicht und Namen. Genannt werden sie allein von Thomas de Waal.
An den geschichtlichen Rückblicken und Konfliktanalysen – löbliche Ausnahmen sind de Waal und Souleimanov – fällt auf, dass der ethnoterritoriale Sowjetföderalismus vor allem als Ungerechtigkeit beschrieben, nicht jedoch als Voraussetzung für die Nationalstaatsbildung erkannt wird. Die führende Rolle von Kaukasiern im Gewaltregime der UdSSR (nicht nur Stalin und Berija) bleibt ebenso unerwähnt wie das Leiden der Opfer ethnonationalistischer Gewalt. Föderalismus als Option der Konfliktregelung scheint nicht einmal ansatzweise auf, aber auch das sonst weithin praktizierte “power-sharing” (besonders im subsaharischen Afrika oder im Libanon) gehört nicht zu den diskutierten Optionen. Kaum eine Untersuchung beleuchtet die Kontinuitäten in den Mustern der Feindbildproduktion von der Sowjetideologie zur nationalistischen Gartenkultur, die Minderheiten als innere Feinde, Fremdstämmige, fünfte Kolonnen oder “eigentlich” der Mehrheitskultur zugehörig betrachtet. Ein ziviles, demokratisches, “verfassungspatriotisches” Verständnis von Staatsbürgerschaft gab es weder zu Sowjetzeiten noch danach.
Komparative, variablen-orientierte Forschung zu den politischen Parteien, zum Herrschaftskern, zu den Herrschaftstechnologien und Reproduktionsmechanismen der (semi-)autoritären Regime im Kaukasus sind nach wie vor ein Forschungsdesiderat. Die sozialwissenschaftliche Regionalforschung zum Kaukasus hinterlässt den Eindruck, dass sie den Anschluss an zentrale Fragestellungen der vergleichenden Politikwissenschaft erst ansatzweise gefunden hat und von der wenig erkenntnisfördernden Gegenüberstellung von “Demokratie” und “Autoritarismus” geprägt ist.
Nach wie vor überwiegen herkömmliche Theoreme der Internationalen Beziehungen und der Transitionsforschung. Diese erfassen lediglich statische Strukturen, nicht aber dynamische Prozesse. Analysen zur Mikrodynamik von Konflikten, zu innergesellschaftlichen Akteurskonfigurationen, zur politischen Ökonomie sowie zu Mustern von Gewaltverhalten sind rar. Gern würde man mehr erfahren zur Funktionsweise der parastaatlichen Gebilde in Bergkarabach, Abchasien und Südossetien, zur Kohäsion bzw. inneren Heterogenität der Konfliktparteien und zu den Spaltungslinien, die den Nord- und Südkaukasus übergreifend charakterisieren. Ferndiagnostik überwiegt gegenüber Feldforschung. Vonnöten ist eine komparative Politikfeldforschung.
Aser Babajew: Weder Krieg noch Frieden im Südkaukasus. Hintergründe, Akteure, Entwicklungen zum Bergkarabach-Konflikt. Baden-Baden: Nomos 2014. 223 S. 39,- Euro
James Forsyth: The Caucasus. A History. Cambridge: Cambridge University Press 2013. 898 S. 145,52 Euro
Andrew Foxall: Ethnic Relations in Post-Soviet Russia. Russians and non-Russians in the North Caucasus. Abingdon, New York: Routledge 2015. 177 S. 135,77 Euro
Nurlan Hasanov: Der Ausbau rechtsstaatlicher Strukturen in der Republik Aserbaidschan, gefördert durch die Europäische Nachbarschaftspolitik. Berlin: Wissenschaftlicher Verlag 2014. 200 S. 30,- Euro
Esmira Jafarova: Conflict Resolution in South Caucasus. Challenges to International Efforts. Lanham, Boulder, New York, London: Lexington Books 2015, 175 S. 77,52 Euro
Michael Kambeck, Sargis Ghazaryan (Hg.): Europe’s Next Avoidable War. Nagorno-Karabakh. Basingstoke: Palgrave Macmillan 2012. 277 S. 67,91 Euro
Ismail Küpeli: Aserbaidschan – ein autoritärer Rentierstaat? Politik und Ökonomie unter dem Aliyev-Regime. Göttingen: Optimus Verlag 2013. 65 S. 29,80 Euro
Florian Mühlfried: Being a State and States of Being in Highland Georgia. New York, Oxford: Berghahn Books 2014. 248 S. 89,89 Euro
Ghia Nodia, Christoph H. Stefes (Hg.): Security, Democracy, and Development in the Southern Caucasus and the Black Sea Region. Bern u.a.: Peter Lang 2015. 380 S. 87,30 Euro
Kevork Oskanian: Fear, Weakness and Power in the Post-Soviet South Caucasus. A Theoretical and Empirical Analysis. Basingstoke: Palgrave Macmillan 2013. 261 S. 100,12 Euro
Louise Shelley, Erik R. Scott, Anthony Latta (Hg.): Organized Crime and Corruption in Georgia. London, New York: Routledge 2007. 129 S. 27,30 Euro
Emil Souleimanov: Understanding Ethnopolitical Conflict. Karabakh, South Ossetia, and Abkhazia Wars Reconsidered. Houndsmills, New York: Palgrave Macmillan 2013. 250 S. 88,61 Euro
Thomas de Waal: Black Garden. Armenia and Azerbaijan Through Peace and War. New York, London: New York University Press 2003. 337 S. 21,95 Euro
Published 23 March 2016
Original in German
First published by Osteuropa 7-10/2016
Contributed by Osteuropa © Andreas Heinemann-Grüder / Osteuropa / Eurozine
PDF/PRINTSubscribe to know what’s worth thinking about.
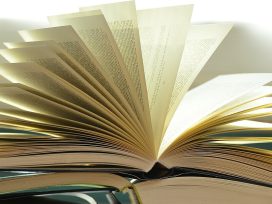
Growing reluctance to engage with books is endangering democracy and science. Deep reading boosts the human capacity for abstract and analytical thinking, protecting us from the corrosive effects of bias, prejudice and conspiracy theories.

In rekto:verso: what the body of the action hero says about relations of power; why yoga’s discourse of accessibility rings hollow; and whether fitness practitioners should really be reading Mishima.