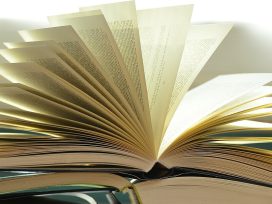Archangel kontra Ambler: Kiloware und Marktgeschrei.
Über den Niedergang eines Genres
Kürzlich bat mich der Londoner Independent um eine Rezension von Archangel. Die deutsche Ausgabe ist zeitgleich mit dem englischen Original unter dem Titel Aurora diesen Herbst bei Heyne erschienen, und ich nehme Archangel zum Anlaß für ein paar grundsätzliche Betrachtungen über das Genre Thriller und Kriminalromane.
Archangel spielt im Moskau der Gegenwart, die Handlung ist jedoch vielfach verknüpft mit der stalinistischen Ära, insbesondere mit Stalins Tod. Im Zentrum steht ein in Wachs gebundenes Notizbuch mit handschriftlichen Aufzeichnungen Stalins, das dessen Geheimdienstchef Berija in einem Safe des Kremls entdeckt und das dann in die Hände eines stalinistischen Ex-Funktionärs gelangt, der es dazu benützt, die Rückkehr des Stalinismus vorzubereiten. Protagonist des Romans ist ein manipulierter englischer Wissenschaftler, der die Echtheit des Notizbuches bestätigen soll. Das Buch ist flott geschrieben, die ausdrucksstark und lebendig gezeichnete russische Kulisse überzeugt den Leser von ihrer Echtheit. Auf den ersten Blick steht der Roman in der Tradition des englischen Thrillers, wie wir ihn von , , , , und zahlreichen anderen Autoren bis zu kennen. Aber eben nur auf den ersten Blick.
Das Buch ist 420 und nicht 250 Seiten stark. Es ist überladen mit einer ominösen Analyse der gegenwärtigen russischen Gesellschaft, die vielleicht zutreffend sein mag, aber keine wirkliche Offenbarung bietet. Darüber hinaus sind die Hauptfiguren erbärmlich klischeehaft gezeichnet. Der mitunter klotzige Stil entbehrt jener Klarheit, die ¹ Vorgänger auszeichnet. Die Handlung schleppt sich dahin und hält nicht durch. Es gibt Ereignisse und Situationen, die noch unwahrscheinlicher anmuten, als irgend etwas, das Buchan oder seine weniger bekannten Zeitgenossen jemals ausgeheckt haben. Der Roman soll offensichtlich beim Leser das Gefühl erzeugen, er hätte tiefe Einblicke in die Zentren der Macht und in die Köpfe der großen Männer erhalten, die unser aller Leben bestimmen. Kurzum: Archangel ist auf dem besten Wege, die Tradition, aus der er kommt, zu verraten, und versucht, eine Nische für seinen Autor und seinen Verleger in der Bestsellerliste zu finden, die von Autoren wie , , , , oder dem späten dominiert wird.
Was charakterisiert nun solch stereotype Bestseller? Sie sind lang, und sie sind kompliziert. Sie sind häufig in einer blassen und gleichzeitig undurchsichtigen Prosa geschrieben, vergleichbar einem Eintopf mit zu wenig Fleisch, aber zu vielen Knorpeln, durch den man sich halt durchlöffelt. Sie vermitteln dem Leser das Gefühl, er und nur er allein (und dies gilt für jeden der 20 Millionen Leser) erfahre Geheimnisse aus der jüngsten Geschichte, die dem Autor unter dem Siegel der Verschwiegenheit anvertraut wurden. Sie blenden die ökonomischen, gesellschaftlichen und historischen Imperative aus, denen unser Leben unterworfen ist und bestehen darauf, daß Geschichte von Persönlichkeiten gemacht wird – zudem noch von psychopathischen. Zufälligkeiten, Mißgeschick oder Glück, die das Leben eines Individuums in Wirklichkeit doch sehr bestimmen, werden fast völlig ignoriert, außer der Autor manövriert die Handlung in eine Sackgasse, aus der sie eben nur noch durch einen haarsträubenden Zufall herauszubekommen ist. Die billigsten Machwerke in diesem unteren Marktsegment spielen im allgemeinen, zumindest passagenweise, an exotischen, aber wiederum nicht allzu exotischen Plätzen: Karibische Schlupfwinkel, alpine Schlösser werden strapaziert, der Bösewicht verfügt gerne über eine Yacht und einen sadistischen Leibwächter und neigt zu abnormalen – zumindest ungewöhnlichen – sexuellen Praktiken. Ganz so schrecklich geht es in Archangel zwar noch nicht zu, doch es ist letztlich eine Frage der Zeit, wie lange sich den schlimmsten Exzessen dieses Subgenres entziehen kann, wenn der Druck, alle zwei Jahre mindestens einen Superbestseller zu schreiben, seinen Tribut fordert.
Ist das alles so wichtig? Ich denke schon. Das Bestseller-Genre hat nur sehr wenige Bücher hervorgebracht, die einen bleibenden Wert besitzen. Bestseller werden gekauft als Lesefutter für einen Langstreckenflug, oder man verschenkt sie zu Weihnachten. Sie haben inzwischen jene Thriller-Gattung völlig vom Markt verdrängt, aus der sie hervorgegangen sind. Das waren Bücher, die man immer wieder lesen konnte, Bücher, die heute vergriffen sind, oder die, schriebe man sie heute, praktisch keine Chance hätten, auf den Markt zu kommen. Der englische Erzvater dieses Genres war . Auch er hatte seine Schablone, und ein wenig davon ist auch in Archangel zu spüren. Ein Durchschnittsmensch, ein Geschäftsmann, ein Journalist, ein Akademiker oder ein Ingenieur (Ambler, selbst ein ausgebildeter Ingenieur, arbeitete in diesem Beruf, bevor er Schriftsteller wurde) stolpert in eine Intrige oder wird in sie hineingezogen, er wird in Spionage und Verbrechen verwickelt und muß einiges durchmachen. Das ist, stark abstrahiert, das Grundmuster. Das Faszinierende aber an Amblers Büchern liegt darin, wie er die Hauptfigur mit den Mächten der Geschichte verknüpft, mit dem Kalten Krieg (Das Intercom-Komplott), mit dem Palästinakonflikt (Der Levantiner), mit der kommunistischen Subversion im Fernen Osten (Waffenschmuggel). Ambler vergreift sich jedoch nie an historischen Persönlichkeiten. Sozusagen auf Straßenniveau wird der Einfluß geschichtlicher Kräfte erfahren und ist deshalb auch zu verstehen. Amblers Prosa fließt frisch wie ein Quell, frei von neobarocken Beschreibungen; Sex und Brutalität kommt der ihnen gebührende periphere Platz in unserem Leben zu, ebenso Liebe, Haß, Habgier und Rachsucht. Technisches Know-how und Hardware unterstützen den Plot und sind nicht dazu da, den Leser zu beeindrucken oder ihm zu schmeicheln.
Im englischen Buchhandel ist momentan nicht ein einziges Werk von Ambler erhältlich, in Amerika immerhin drei oder vier. Was ist geschehen? Die Antwort ist ebenso einfach wie langweilig: Globalisierung, Markt, Warenfetischismus und der unvermeidliche Hang aller Produkte des Kapitalismus zum Verlust ihrer Individualität, zur gegenseitigen Nachahmung, zur Uniformierung. Verleger und Autoren mögen glauben, sie seien davon nicht betroffen. Wirklich nicht? Welch ein Irrtum! Die erste Frage, die ein Verleger stellt, wenn er ein Manuskript erhält, lautet: «Unter welchem Etikett kann ich das verkaufen?» Und wenn es in keine Marktnische paßt, landet es entweder im Papierkorb oder wird umgeschrieben. Was heutzutage ein Thriller sein soll, muß mindestens 120.000 Wörter umfassen. Es muß von globalen Ereignissen auf einer imaginären Ebene handeln, die unseren Alltagshorizont übersteigen, es muß eine Art von Spezialwissen aufweisen, das dem Leser schmeichelt, ohne ihm zuzumuten, wirklich etwas zu lernen oder sein Denkvermögen zu strapazieren. Hat der Autor bereits ein Werk veröffentlicht, so darf das neue Buch nicht die Erwartungen des Publikums übertreffen. Es darf nicht wirklich originell oder persönlich sein. Kurzum: Die Funktion des Autors wird auf die eines Handwerkers oder Kunstgewerblers reduziert, der Serienmöbel anfertigt, immer wieder den gleichen Sessel, den gleichen Tisch, und der nur deshalb noch beschäftigt wird, weil «handgemacht» zum Markenimage gehört oder ein entsprechender Computer noch nicht erfunden wurde.
Eine wichtige Rolle kommt bei dieser Veranstaltung dem Autorennamen zu. Der Name steht nicht mehr für eine Person, ein Individuum, sondern verkommt zum Markenzeichen. Wodurch unterscheidet sich Adidas von Nike? Durch den Namen. «Der neue Forsyth» verkünden die Werbeposter in der Untergrundbahn neben denen, die «Das neue verbesserte Waschmittel mit dem prägnanten Namen» annoncieren. Das geht so weit, daß inzwischen allgemein geglaubt und behauptet wird, Lord Archer habe seit Jahren kein Buch mehr geschrieben, sondern ein Stall von Lohnschreibern produziere in seinem Namen. Selbst wenn dies nicht der Wahrheit entspricht, reicht die bloße Plausibilität des Verdachts aus, um meine Thesen zu bestätigen.
Wie dem auch sei, in den Bücherregalen stehen identische Produkte Rücken an Rücken, alle gleich dick, mit den gleichen in Gold geprägten Titeln, immer noch eine ganze Menge von Namen, vielleicht so an die vierzig. Vierzig? Gerade vierzig Autoren, aus denen einige Milliarden Leser auf der ganzen Welt wählen können? Heutzutage kann man keinen Thriller mehr publizieren, der nicht in hohem Maß nach den hier beschriebenen Mustern gestrickt ist. Ich schreibe hier über die Unterkategorie des Kriminalromans, doch der gleiche Prozeß findet in allen anderen Subkategorien statt. Alle unterliegen sie ähnlichen Marktzwängen, Produktions-, Verteilungs-, Buchhaltungskosten und allem, was es sonst noch unabdingbar macht, daß jeder Bestseller eben dick sein muß. Nehmen wir den traditionellen englischen Kriminalroman. Wenn wir die Werke von , , mit jenen von , oder vergleichen, so fällt als erstes auf, daß erstere dicke Wälzer sind. Oder nehmen wir knallharte amerikanische Fiction: In einen passen drei . Sogar sporadisch doch immer wieder auf ihren eigenen Schreibstil pochende Autoren wie oder kommen heute mit doppelt so dicken Büchern wie ein daher.
Das Hauptproblem aller modernen Autoren von Kriminalromanen bleibt die «Nische». Mosley, Ellroy und Leonard sind zumindest alle einmal aus ihrer Marktnische ausgebrochen mit einem Buch, das sich deutlich von allem unterschied, was sie vorher geschrieben hatten, das aus dem Territorium ausbrach, das sie früher beherrschten, oder das einen ganz neuen Ansatz verfolgte. Ich kenne zwar nicht die Verkaufszahlen dieser Bücher, doch vermute ich, ihre Verleger werden ihnen kein zweites Mal Gelegenheit bieten, so zu schreiben. Doch letzten Endes liegt all dies weder am Verleger, noch am Leser, nicht einmal am Buchhändler, denn alle müssen ihr Geld verdienen. Vielmehr ist diese Entwicklung nur ein kleiner Teil des Globalisierungsprozesses, der alles nivelliert: unser Essen, unsere Autos, unsere Kleider, die Musik, die Einkaufszentren, selbst die Laternenpfähle in den Einkaufszentren.
Sie sehnen sich nach den guten alten Zeiten zurück? Sie möchten diesen Prozeß stoppen? Sie wünschen sich Romane, Kriminalromane, die Sinn, Inhalt, Emotion und Individualität transportieren? Dann müssen Sie auf die Barrikaden klettern und die Laternenpfähle zu Zwecken einsetzen, die die Computer, von denen sie entworfen wurden, nicht vorgesehen haben.
Published 24 January 1999
Original in English
Translated by
Andrea Marenzeller, Walter Famler
Contributed by wespennest © Julian Rathbone
PDF/PRINTNewsletter
Subscribe to know what’s worth thinking about.