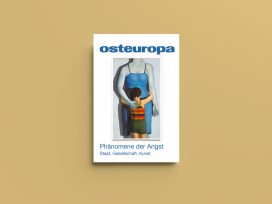Wie die Schlussakte von Helsinki mein Leben verändert hat
Ich erinnere mich genau daran, was ich am Morgen des 21. August 1968 tat, als sowjetische Truppen in die Tschechoslowakei einmarschierten. Ich war elf Jahre alt und verbrachte den Sommer mit meinen Eltern auf einer Hütte. Von einem Hügel aus beobachtete ich die Panzerkolonne im Tal und sah meinen Vater zum ersten Mal weinen.
Ich erinnere mich genau daran, was ich am 17. November 1989 tat, als die Polizei in Prag Studenten zusammenschlug, wonach das kommunistische Regime zu bröckeln begann. Ich war bei einem Treffen verbotener Schriftsteller, und als wir auf Radio Free Europe hörten, was passiert war, stiegen wir in unsere Autos und fuhren nach Bratislava, im Bewusstsein, dass etwas Historisches geschah.
Aber was habe ich am 1. August 1975 gemacht, als die Staats- und Regierungschefs von 35 Ländern in der finnischen Hauptstadt die Schlussakte von Helsinki unterzeichneten? Ich habe versucht, es zu rekonstruieren und bin zu dem Schluss gekommen, dass ich an diesem Tag wohl mit meinem Bruder zum Wandern in der slowakischen Tatra war.
Die Unterzeichnung der Schlussakte von Helsinki war ein Ereignis, das direkten Einfluss auf den Zusammenbruch des Sowjetimperiums hatte, aber ich persönlich habe nur eine vage Erinnerung an die Schlagzeilen in der kommunistischen Presse. Die Zeitung feierte das Dokument als großen Sieg für die sowjetische Diplomatie – Grund genug für mich, zu ignorieren, was dort oben in Finnland geschehen war.
Ich erinnere mich jedoch an ein scheinbar unbedeutendes Ereignis anderthalb Jahre später, am 31. Dezember 1976, das in direktem Zusammenhang mit der Schlussakte von Helsinki stand. Ein Fremder klingelte an der Tür unserer Wohnung. Als ich öffnete, reichte er mir einen Umschlag und sagte, ich solle ihn meinem Vater geben. Dann verschwand er.
Dieser Fremde hatte etwas Riskantes getan, denn unsere Familie stand unter ständiger Beobachtung. Er war wahrscheinlich davon ausgegangen, dass die Staatssicherheit an Silvester nicht im Dienst ist. Der Umschlag enthielt einige getippte Seiten mit dem Titel „Erklärung der Charta 77“ („Prohlášení Charty 77“). Die Unterzeichner waren Freunde meines Vaters: der Philosoph Jan Patočka (der drei Monate später nach einem achtstündigem Verhör durch die Staatsicherheit starb), der Dramatiker Václav Havel und der ehemalige Politiker Jiří Hájek.
Mein Vater, Milan Šimečka – ein Philosoph und Dissident, der in Bratislava, weit entfernt von Prag, lebte – las den Text und bemerkte verärgert, dass seine tschechischen Freunde beim Verfassen des Textes die Slowaken vergessen hätten und nun von ihnen, von ihm, nur noch eine Unterschrift wollten.
Ich habe so oft gelesen, dass mein Vater Unterzeichner der Charta 77 war, dass ich es aufgegeben habe, diesen Irrtum zu korrigieren. Es spielt tatsächlich kaum eine Rolle, da die Biographie und die Haltung meines Vaters sich mit denen der Unterzeichner weitgehend deckte – Gefängnis inklusive. Tatsache ist jedoch, dass mein Vater die Charta 77 nicht unterzeichnet hat. Er war zu sehr über die Selbstbezogenheit seiner Freunde in Prag verärgert.
Aber warum habe ich sie nicht unterzeichnet? Ich hatte keinen Grund, verärgert zu sein. Ich war 20 Jahre alt und die Kommunisten hatten mir das Studium an der Universität verboten. Ich verdiente meinen Lebensunterhalt als Arbeiter und hatte nichts zu verlieren. Ich war zum Dissidenten geworden, weil ich nach Ansicht der Kommunisten Träger der Erbsünde war. Ich hatte allen Grund, die Charta 77 zu unterzeichnen.
Ich stimmte jedem Satz zu, außer dem, der einen „konstruktiven Dialog mit den politischen und staatlichen Behörden“ vorschlug. Dialog? Auf keinen Fall! Natürlich hätte es sich dabei nur um ein taktisches Manöver handeln können, aber ich wollte nichts mit den Kommunisten zu tun haben. Selbst während der Verhöre durch die Polizei blieb ich standhaft stumm, denn jede Antwort, die ich gegeben hätte, wäre bereits ein Dialog gewesen.
Also unterschrieb ich nicht. Das hinderte mich jedoch nicht daran, den Geist der Charta 77 zu bewundern. Zu den wichtigsten Verfassern des Textes gehörten Pavel Kohout und Ludvík Vaculík, beide ehemalige Kommunisten, die das Regime von innen kannten. Sie verstanden, dass dessen Schwäche ein krankhaftes Verlangen nach westlicher Anerkennung war. Das kommunistische Regime sah die Schlussakte von Helsinki als seinen Sieg an, weil der Westen das Sowjetimperium – einschließlich der Tschechoslowakei – als Partner akzeptierte. Die Tatsache, dass die Tschechoslowakei gleichzeitig zugestimmt hatte, die Menschenrechte zu achten, wurde als unbedeutendes Zugeständnis angesehen, über das die Bürger nicht informiert werden mussten. (Obwohl diese es selbst lesen konnten, die Schlussakte wurde am 13. Oktober 1976 in der Gesetzessammlung veröffentlicht).
Die Charta 77 war ein sorgfältig gezielter Schlag, denn sie warf dem Regime vor, die in Helsinki formell eingegangene Verpflichtung zu ignorieren. Als das Manifest im Januar 1977 in westlichen Zeitungen veröffentlicht wurde, betrachtete das Regime dies – zu Recht – als direkten Angriff auf seine Legitimität.
Selbst die Unterzeichner hatten nicht mit einer solchen Wirkung gerechnet. Es folgte eine beispiellose Welle der Unterdrückung, begleitet von einer massiven Propagandakampagne zur Verteidigung der Legitimität des Regimes. Bei öffentlichen Versammlungen im ganzen Land stimmten Hunderttausende für eine Resolution zur Verurteilung der Charta 77, obwohl die überwiegende Mehrheit von ihnen diese gar nicht gelesen hatte. Schließlich war jede Neuveröffentlichung verboten worden.
Das Regime zwang Tausende von Künstlern aus allen Bereichen des öffentlichen Lebens, durch die Unterzeichnung der Resolution ihre Loyalität zu bekunden. Die berühmtesten Schauspieler und Sänger der Tschechoslowakei sprachen sich in Live-Fernsehübertragungen gegen die Charta 77 aus. Es war eine Orgie der Konformität und Feigheit. Diese „Anti-Charta“ wurde nach 1989 zu einer Art Schandtafel, mehrere Künstler entschuldigten sich später öffentlich dafür, dass sie sie unterzeichnet hatten.
Damals schien die Schlussakte von Helsinki jedoch einen Sieg für die kommunistischen Regime zu bedeuten. Die brutale Unterdrückung von Dissidenten in der Tschechoslowakei bestätigte dies. Ich war nicht der Einzige, der die Bemühungen des Westens um eine Entspannung mit dem Sowjetimperium als Verrat an den Millionen von Menschen betrachtete, die unter dem Kommunismus litten. Ich war überzeugt, dass der Dialog zwischen dem demokratischen Westen und den Diktaturen des Ostens nichts anderes als perfide war.
Wendepunkt
Fünfzehn Jahre später stellte sich heraus, dass ich mich geirrt hatte – und dass auch die kommunistischen Diktaturen sich geirrt hatten. Der Handel mit dem Westen, von dem sie sich eine Stärkung ihrer Wirtschaft versprochen hatten, konnte ihre Rückständigkeit nicht beheben. Die westlichen Garantien der Nichteinmischung konnten den inneren Zerfall des Sowjetimperiums nicht aufhalten.
Es war auch offensichtlich geworden, dass das angeblich in dem Dokument enthaltene Bekenntnis zum Frieden nichts als eine Illusion war. Ich lebte die gesamten 1980er Jahre in einer Atmosphäre hysterischer Angst. Täglich versetzte uns die kommunistische Propaganda mit Warnungen vor dem Einsatz einer „Neutronenbombe“ durch Amerika und dem Beginn eines „Krieges der Sterne“ in Furcht und Schrecken.
Die westdeutschen Friedensaktivisten, die Massenkundgebungen gegen die Stationierung amerikanischer Pershing-Raketen in Europa organisierten, waren von derselben Hysterie erfasst. Zu meinem Erstaunen protestierten sie jedoch nicht gegen die russischen Atomsprengköpfe, die auf sie gerichtet waren. Wie François Mitterrand in einer Rede vor dem Deutschen Bundestag lakonisch bemerkte: „Die Raketen sind im Osten, die Pazifisten sind im Westen.“ Bis heute wissen wir nicht genau, wie viele dieser Raketen in der Tschechoslowakei stationiert waren.
Nach alledem schien die Schlussakte von Helsinki nur ein Stück Papier zu sein, ein weiteres internationales Dokument, das niemand ernst nahm. Aber wie Henry Kissinger in seinen Memoiren bemerkt: „Wendepunkte werden von Zeitgenossen oft nicht erkannt.“
Der eigentliche Wendepunkt – der berühmte „dritte Korb“ der Helsinki-Schlussakte, der alle Formulierungen zu Menschenrechten und Freiheiten enthielt – kam mir damals wie ein bloß formaler Zusatz vor, durch den der Westen sein schlechtes Gewissen beruhigen konnte, nachdem er Ostmitteleuropa Stalin überlassen hatte. Aber es ging um mehr. Was die kommunistischen Staaten als bloße Verzierung eines Dokuments betrachteten, das de facto die Abkommen von Jalta über die Teilung Europas anerkannte, erwies sich letztlich als der Hammer, der Stück für Stück den Beton des Sowjetimperiums zertrümmerte.
Dennoch hatte die Schlussakte von Helsinki in der Tschechoslowakei der späten 1970er und frühen 1980er Jahre zunächst eher mehr vom Gleichen gebracht, nur noch schlimmer. Václav Havel verbrachte vier Jahre im Gefängnis, mein Vater mehr als ein Jahr. Die Verfolgung von Dissidenten wurde noch grausamer, die Geheimpolizei erweiterte ihre Methoden und begann, zusätzlich zur bürokratischen Unterdrückung, „Charta-Anhänger“ zu verprügeln, zu schikanieren und ins Exil zu treiben.
In Polen unterdrückten die Kommunisten die Solidarność-Bewegung rücksichtslos und beriefen sich darauf, dass die Schlussakte den Staaten das Recht zugestand, im eigenen Land nach Gutdünken vorzugehen, ohne jede Einmischung von außen. Auch die Kommunisten in der Tschechoslowakei argumentierten häufig so. Jede Kritik aus dem Westen an der Verfolgung von Dissidenten wurde empört als „Einmischung in die inneren Angelegenheiten“ zurückgewiesen.
Ich hatte also keinen Grund zu glauben, dass sich etwas ändern würde. Ich war vielmehr überzeugt, dass ich meine Freiheit selbst verteidigen musste, ohne die Hilfe des Westens, und dass dies eine lebenslange Aufgabe sein würde. Ich hätte nie gedacht, dass das kommunistische Regime noch zu meinen Lebzeiten fallen könnte.
Doch allmählich begann sich etwas zu ändern. Die ganzen 1970er Jahren über traf ich keinen einzigen Westler – natürlich hatte niemand in meiner Familie vor 1989 einen Reisepass, wir konnten das Land also nicht verlassen. Aber ab 1980 klingelten von Zeit zu Zeit fremde Menschen an unserer Tür und stellten sich als Journalisten vor, oder als ein Professor aus Oxford, der gekommen war, um vor den wenigen Dissidenten, für die der intellektuelle Gewinn das Risiko eines polizeilichen Verhörs wert war, eine Philosophievorlesung zu halten.
Es fühlte sich an, als wären wir Gegenstand einer anthropologischen Feldstudie. Menschen aus einer anderen Zivilisation kamen in unsere kommunistische Wildnis, und ich war erstaunt, dass sie sich für uns interessierten. Ich glaubte nicht daran, dass Besuche aus dem Westen etwas ändern würden. Aber die Entdeckung, dass es hinter dem Eisernen Vorhang Menschen gab, die genauso über Freiheit dachten wie wir, war für uns und für mich persönlich von enormer Bedeutung. Ohne Helsinki hätten sie die Tschechoslowakei niemals besuchen können.
Irgendwann in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre kam der Vorsitzende der Helsinki- Föderation für Menschenrechte, Karel Schwarzenberg, zu Besuch nach Bratislava. Also lud mein Vater ihn zum Abendessen ein. Als ich Schwarzenberg fragte, wie er es als jemand, der den Kommunisten in der Tschechoslowakei als Staatsfeind galt, geschafft hatte, einzureisen, lächelte er nur und sagte: „Sie waren verpflichtet, mich durchzulassen.“
Da verstand ich endlich die ganze Bedeutung der Schlussakte von Helsinki.
Von Soft Power zu No Power
Zu dieser Zeit entstanden in der Tschechoslowakei immer mehr Initiativen und Vereinigungen mit Namen wie „Helsinki-Komitee“ oder „Bewegung für Bürgerfreiheit“ (Hnutí za občanskou svobodu). Bald gab es so viele, dass das Regime sie nicht mehr alle unterdrücken konnte. Sie alle variierten die Charta 77. Und alle bezogen sich auf die Schlussakte von Helsinki.
Diese Organisationen stützten sich auf die Menschenrechte, deren Legitimität die Kommunisten 1975 offiziell anerkannt hatten. Sie setzten auf Dialog, obwohl die Behörden diesen weiterhin ablehnten. Ich hatte daher keinen Grund, meine eigene Position zu ändern. Ich bewunderte die Fantasie und Ausdauer der Charta-Anhänger sehr, war aber dennoch nicht daran interessiert, mit einem gewalttätigen Regime zu verhandeln.
Möglicherweise wären die sklerotischen kommunistischen Systeme in Osteuropa letztlich auch ohne die Schlussakte von Helsinki und ihren dritten Korb, vielleicht sogar ohne die Dissidenten zusammengebrochen. Aber einem solchen Zusammenbruch hätte ein wesentliches Element gefehlt: das Ethos der Menschenrechte, das die Dissidenten verkörperten und das auf der Grundlage der Schlussakte entstanden war.
Heute wird oft angenommen, dass die Menschenrechte zum Fall des Kommunismus geführt haben, als wäre dies eine natürliche oder sogar notwendige Entwicklung gewesen. Aber es hätte keineswegs so kommen müssen – wie das Beispiel Chinas nur allzu deutlich gezeigt hat. Die Menschenrechte wurden nur durch die Vorstellungskraft und Beharrlichkeit der Dissidenten im Osten und der Aktivisten im Westen zu einem wirksamen politischen Instrument für den Wandel. Ohne diese Menschen wäre die Schlussakte von Helsinki ein Dokument ohne Bedeutung geblieben.
Die Idee der Menschenrechte half den Staaten Mitteleuropas, den Übergang zur Demokratie mit bemerkenswerter Geschwindigkeit zu bewältigen. Der Prozess wurde von einer starken Dissidentenbewegung begleitet und unterstützt, die vor allem von Václav Havel, der im Dezember 1989 Präsident der Tschechoslowakei wurde, gefördert wurde. In den postkommunistischen Staaten, in denen keine Dissidenten an die Macht kamen, beispielsweise im ehemaligen Jugoslawien, in Rumänien und Bulgarien, dauerte der Übergang viel länger. In einigen Fällen, etwa in Russland, scheiterte er vollständig.
Die Soft Power der Schlussakte von Helsinki beschleunigte zweifellos den Zusammenbruch des kommunistischen Imperiums. Aber Hard Power stellte diese nicht zur Verfügung. Wenn ein Staat sich entschied, sie zu ignorieren, half sie nicht. Machtlosigkeit, als die Sowjetunion Ende 1979 in Afghanistan einmarschierte; Machtlosigkeit, als die serbischen Nationalisten in den 1990er Jahren in Sarajevo, Srebrenica und im Kosovo so viele Menschen töteten. Und auch gegen Russlands Aggression in der Ukraine heute hilft die Schlussakte nicht.
Dies ist kein Vorwurf an die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), die auf den in Helsinki festgelegten Grundsätzen der Menschenrechte und Freiheiten basiert. Aber ihre Autorität verpufft augenblicklich, sobald ein Staat diese Grundsätze offen missachtet.
Russland ist ein Paradebeispiel dafür. In der ersten Hälfte der 1990er Jahre wollte Boris El’cin den Westen dazu bringen, sich auf die Zusammenarbeit innerhalb der OSZE zu konzentrieren, anstatt die ostmitteleuropäischen Staaten in die NATO aufzunehmen. (Allerdings erkannte El’cin 1993 in Warschau öffentlich an, dass die Schlussakte von Helsinki diesen Staaten das Recht gab, „ihre Bündnisse zu wählen“). Ich fürchtete, der Westen könnte sich auf das Spiel Russlands einlassen, und begann, die OSZE als Risiko zu betrachten. Die Organisation hat keine Hard Power und bot daher keinen Schutz vor einem erneuten Versuch Russlands, den jungen und fragilen Staat, in dem ich lebte, zu unterwerfen. Zu dieser Zeit wurde die Slowakei von Vladimir Mečiar regiert, einem autoritären Populisten, den El’cin als seinen Freund bezeichnete.
Mit anderen Worten: Die OSZE wurde plötzlich zum Schreckgespenst eines Kompromisses zwischen Russland und dem Westen. Ich wollte mich nicht auf die OSZE verlassen, um meine Freiheit zu schützen, weil ich wusste, dass sie dazu nicht in der Lage war. Die Kriege in Jugoslawien waren ein tragischer Beweis dafür. Ich befürchtete, dass der Westen zurückweichen würde und die OSZE als Vorwand dafür dienen würde. Erst als klar wurde, dass die Slowakei Mitglied der NATO und der EU werden würde, ließen meine Ängste nach.
Seitdem habe ich das Interesse an der OSZE verloren. Ich bin nicht der Einzige. Wie oft hat die OSZE in den letzten zwei Jahrzehnten etwas getan, das die Aufmerksamkeit der europäischen Medien auf sich gezogen hat? Auch dies ist kein Vorwurf. Die Schlussakte von Helsinki wurde zu einer Zeit unterzeichnet, als der Westen und der Osten versuchten, einen Krieg zu vermeiden. Die meisten Staaten wurden damals noch von Politikern geführt, die den Zweiten Weltkrieg selbst erlebt hatten.
Fünfzig Jahre später sieht die Welt ganz anders aus. Russland hat einen Krieg gegen die Ukraine begonnen und ignoriert internationale Verträge und Abkommen. Das 1994 von Russland (zusammen mit den USA, Großbritannien und der Ukraine) unterzeichnete Budapester Memorandum, das die Souveränität der Ukraine im Gegenzug für die Aufgabe ihrer Atomwaffen garantieren sollte, ist ebenso wie die „Minsker Vereinbarungen“ Makulatur geworden.
In einer Welt, in der internationale Verträge keine Gültigkeit mehr haben, ist die OSZE eine Organisation ohne Autorität. In Ländern, in denen Menschenrechte massiv verletzt werden, mögen Dissidenten vielleicht noch das Gefühl haben, dass die OSZE sich für ihr Schicksal interessiert. Das ist besser als nichts. Aber die Soft Power der Schlussakte von Helsinki ist erschöpft, gerade weil die Autokraten von heute nicht einmal mehr vorgeben, ihre Prinzipien anzuerkennen.
Das 1975 unterzeichnete Dokument verschaffte den Dissidenten in Osteuropa Raum, und sie brachten genügend Vorstellungskraft mit, diesen Raum zu nutzen. Der historische Moment, in dem wir heute leben, erfordert ebenfalls die Vorstellungskraft derer, denen Demokratie am Herzen liegt. Aber das Wesen der Vorstellungskraft liegt darin, etwas Neues zu ersinnen. Alte Formeln funktionieren nicht mehr, die Vergangenheit lässt sich nicht wiederholen.
Vielleicht zeichnet sich gerade in diesem Moment eine weitere „Wende“ ab. Eine Wende, die wir, die „Zeitgenossen“, noch nicht vollständig verstehen. Es wäre schön, wenn dies unter dem Dach der OSZE geschehen würde. Aber ich fürchte, dies ist nicht der Fall.
Published 27 October 2025
Original in English
Translated by
Volker Weichsel
First published by Eurozine (English version); Osteuropa 8-9/2025 (German version)
© Martin M. Simecka / Debates on Europe / Osteuropa / Eurozine
PDF/PRINTNewsletter
Subscribe to know what’s worth thinking about.