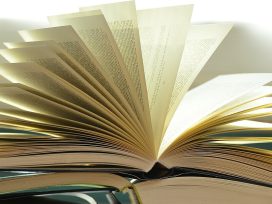"Vierzig Jahre vergehen für niemanden umsonst..."
Ein Gespräch mit von Georg Pichler
Wenn man Ihre Biografie liest, ist man erstaunt über Ihre vielen Facetten. Sie sind nicht nur einer der angesehensten kubanischen Schriftsteller, sondern auch Filmemacher, geben eine Zeitschrift heraus und werden immer mehr zu einem Politikum innerhalb des kubanischen Exils. Begonnen haben Sie noch sehr jung als Schriftsteller, Dozent an der Universität von Havanna, Verteidiger der kubanischen Revolution und Mitherausgeber zweier sehr wichtiger Zeitschriften, El caimán barbudo (Der bärtige Kaiman), und Pensamiento Crítico (Kritisches Denken).
El caimán barbudo war die Kulturbeilage der Zeitung Juventud Rebelde. Ich war siebzehn Nummern lang Herausgeber. Die Zeitschrift existiert zwar immer noch, aber sie hat sehr wenig mit dem zu tun, was wir damals machten. Der Titel war eine Metapher für das revolutionäre Kuba, wir standen zur Revolution. Wir wollten, wie die meisten jungen Schriftsteller, unsere literarischen Väter ermorden und in literarischen Debatten unsere Positionen klären. Bis mich dann der Erste Sekretär der Vereinigung der Jungen Kommunisten mit der entschiedenen Zustimmung Fidels mit lächerlichen Begründungen hinauswarf.
Und Pensamiento Crítico?
Pensamiento Crítico erschien zwischen 1967 und 1971. Es war eine Monatsschrift für Sozialwissenschaften, die meiner Meinung nach das außerordentliche Verdienst hatte, die theoretischen Grundlagen der achtundsechziger Generation und aller damit verbundenen Bewegungen in Kuba bekannt zu machen. Doch war der Hauptmangel der Zeitschrift, die kubanische Revolution nicht kritisch zu reflektieren. Dennoch waren wir Herausgeber, die wir alle auch am Institut für Philosophie der Universität von Havanna lehrten, den Behörden zu kritisch, so dass sie 1971 beschlossen, nicht nur die Zeitschrift aufzulösen und uns auf die Straße zu setzen, sondern auch das Institut zu schließen und das Gebäude gleich niederzuwalzen.
Die Protagonisten Ihres Romans Die verlorenen Worte veröffentlichen eine Zeitschrift, die an den Caimán erinnert. In diesem Roman behandeln Sie die sechziger Jahre in Kuba. Es kommen reale Personen vor, eine der Figuren scheint ein Porträt des Autors selbst zu sein. Inwiefern entspricht der Roman der Realität?
Ich glaube, dass die Figuren nur einer literarischen Realität entsprechen. Tatsächlich sind die realen Personen Modelle für die Figuren des Romans. Während ich am Roman schrieb, wollte ich eine Zeit lang für die Figuren des Roten und des Dicken Gedichte von Luis Rogelio Nogueras und Guillermo Rodríguez Rivera verwenden, die diese Spitznamen trugen. Doch kam ich davon ab, denn der Rote und der Dicke waren rein fiktionale Figuren, so dass ich ihre Gedichte selbst schrieb. Der ganze Roman spielt im Reich der Fiktion. Sogar die Figuren mit Eigennamen, wie etwa Lezama Lima, Carpentier oder Virgilio Piñera, werden wie fiktionale Figuren dargestellt, auch wenn wir Kontakte zu ihnen hatten und etwa die Epitaphien auf sie wirklich schrieben. Doch will der Roman nicht biografisch sein.
Ich frage, da es im Roman zwei Erzählebenen gibt. Auf der ersten finden die Ereignisse Anfang der sechziger Jahre statt, auf der zweiten, die in Moskau spielt, sprechen zwei der Figuren zehn Jahre später über diese Geschehnisse und das, was seither passiert ist. Hier sieht sich Protagonist moralisch dazu verpflichtet, über seine Erinnerungen zu berichten. War diese Überlegung für Sie ein Antrieb, den Roman zu schreiben?
Ja, aber sobald man das alles in Fiktion übersetzt, merkt man, dass man nicht nur selbst vor diesem Problem steht, sondern dass es auch in anderen Kulturen eine Konstante ist. Wir haben einen Schriftsteller, der noch nichts veröffentlicht hat, etwas über dreißig ist und eine Art Vermächtnis in sich trägt, eine Art Verpflichtung all dem gegenüber, was er erlebt hat, auch angesichts des Schweigens. Ich glaube, dass dies mein Fall war und dass daraus dieser Roman entstanden ist. Wenn man aber den Angriff gegen das Centro de Estudios de América oder die Repressalien gegen Zeitschriften hier oder in Russland in Betracht zieht, dann ist es nicht mehr bloß meine persönliche Geschichte, meine Biografie, sondern ein Wert, der weit über diese Erfahrung hinausgeht.
Bei diesem Gespräch in Moskau sagt der Lange, dass er den Roman erneuern will. Was meinen Sie mit dieser Erneuerung der Gattung?
Ich wollte einen Roman schaffen, in dem alle Genres vorkommen: Erzählung, Lyrik, Interview, Essay, aber nicht als Anthologie, sondern so, dass jeder dieser Texte notwendig sein und den Gang der Handlung bereichern sollte. Der Anlass dafür ist die Gründung der Literaturbeilage, die tatsächlich entsteht und an deren Schaffung man teilnimmt. Aber es gibt auch sehr viele Anspielungen im Roman, verschiedene Bedeutungsschichten, Reflexionen über historische Ereignisse, über die Freundschaft. Und das alles sollte ein Roman sein. Man kann den Ursprung auch darin suchen, was Italo Calvino “exponentielle Literatur” genannt hat. Calvino zufolge ist dies die eigentliche Gattung des zwanzigsten Jahrhunderts, erfunden von Borges. In vielen seiner Erzählungen geht Borges davon aus, dass das Buch, auf das er sich bezieht, bereits geschrieben ist. Dies erlaubt ihm, auf relativ geringem Raum sehr viel Sinn zu konzentrieren und sich auf mehrere Realitätsschichten zu beziehen. Ich versuche zwar, es zu verbergen, aber Borges fasziniert mich als Autor ungemein. Dieses exponentielle Spiel mit den verschiedenen Ebenen des Romans ist auch in meinem darauf folgenden Roman, Die Haut und die Maske, präsent, wenn auch auf andere Weise. Hier laufen zwei Realitäten parallel, eine des Films und eine andere, die das Leben der Gruppe beschreibt, die den Film dreht. Es sind zwei vollkommen verschiedene Realitäten, die aber nebeneinander existieren, doch existieren sie nicht aufgrund des externen Willens des Autors, sondern aufgrund der stattfindenden Ereignisse, eben der Dreharbeiten. Die beiden Romane gehören mit Die Initialen der Erde zu einem Zyklus. Ihre Gemeinsamkeit ist, dass sie keine freie Struktur haben. Der Autor, also ich, unterwerfe mich freiwillig einem vorgegebenen Ablauf, der durch die äußeren Umstände der Hauptfigur bestimmt wird. In Die verlorenen Worte ist das die Erstellung der Literaturbeilage, bei Die Haut und die Maske sind es die Dreharbeiten für den Film. Danach kommt ein neuer Korpus mit Erzähl mir von Kuba, Siberiana, den dritten Roman werde ich dieses Jahr fertig stellen, er wird Las cuatro fugas de Manuel (Die vier Fluchten Manuels) heißen. Kurioserweise sind dies Romane, die sich immer weiter von Kuba entfernen. In Erzähl mir von Kuba spielt der halbe Roman auf der Insel, selbst wenn die Gegenwart des Romans in Miami stattfindet. In Siberiana gibt es ein Kapitel, das in Kuba spielt, drei aber in Sibirien. Und Die vier Fluchten Manuels ist zur Gänze in Europa angesiedelt.
Ihr erster Roman, Die Initialen der Erde, ist ein enormes Fresko der kubanischen Revolution und zugleich ein Entwicklungsroman eines “Antihelden unserer Zeit”, eines Menschen, der, obwohl er möchte, den vorgeschriebenen Wegen der kubanischen Revolution nicht folgen kann.
Ich schrieb den Roman zwischen 1971 und 1973, doch ließ ihn die Zensur nicht veröffentlichen.
Mit welcher Begründung?
Mit keiner. In der Welt Kafkas gibt es keine Begründungen. Er blieb zwölf Jahre lang verboten, ohne dass man mir je eine Begründung gegeben hätte. 1985 war der Text immer noch verboten, ich konnte ihn aber auch nicht mehr lesen und auch nicht schreiben, ich war nicht ganz klar im Kopf.
Was heißt “nicht ganz klar im Kopf”?
Ich hatte eine sehr seltene Krankheit, die “Syndrom schlechter Absorption” heißt, was bedeutet, dass du das, was du isst, nicht verdaust. Ich verlor sehr viel Gewicht, ging zu Spezialisten, die aber lange nicht herausfanden, was mir fehlte, bis mir schließlich ein sehr intelligenter Arzt sagte, dass mein Problem nichts mit dem Verdauungstrakt zu tun habe. Dein Körper hat beschlossen, sich umzubringen, und das musst du selbst im Kopf lösen, für dich gibt es keine Medizin. So machte ich mit der Welt der Literatur Schluss, mit der Welt des Verbots. Ich begann Filme zu drehen, reiste. Den Roman konnte ich aber erst zwölf Jahre später wieder lesen, als ich ihn veröffentlichen durfte. Als ich ihn dann las, gefiel er mir nicht mehr. Deshalb habe ich ihn zwischen 1985 und 1987 neu geschrieben.
Der Roman wurde 1987 in Madrid, kurz danach in Kuba veröffentlicht. Wie waren die Reaktionen?
Ich glaube, es war ein Roman, der eine Generation prägte. Die erste Auflage mit 35.000 Stück war in drei Tagen ausverkauft, die Menschen hatten Angst, dass er wieder zurückgezogen würde. Es liegt sehr viel Religiosität in den Handlungen des Protagonisten, sehr viel Katholisches, er glaubt immer, der Sache nicht würdig zu sein, es gibt etwas, das er nicht lösen kann. Andererseits gibt es auch hier das Spiel mit der vorgeschriebenen Handlung, das dann am Ende, in der Versammlung, die über ihn zu richten hat, seinen Höhepunkt findet. Das Leben lässt sich jedoch nicht nach einem vorgegebenen Schema interpretieren. Deshalb möchte ich den Leser fragen, und der Leser steht dann plötzlich selbst vor einem Spiegel und muss entscheiden. Das Ende eines Romans ist für mich ein wichtiger literarischer Rekurs. Viele Leute riefen mich nach dem Erscheinen der Initialen an oder sprachen mich auch auf der Straße an, um zu fragen, wie denn der Roman endete. Ich sagte ihnen, dass er eben so endet, wie er endet, die Antwort müsse jeder für sich finden. Daraufhin waren viele irritiert und meinten, ich als Autor müsse entscheiden, wie er zu enden habe.
Eine andere, weniger bekannte Facette ist die des Filmemachers. Nachdem Sie die Universität verlassen mussten, widmeten Sie sich dem Film.
Ja, denn ich musste ja essen. Als die beiden Zeitschriften und das Institut für Philosophie geschlossen wurden, war ich plötzlich arbeitslos. Ich konnte im selben Bereich keine Arbeit suchen. So ging ich zum Film, da ich dort ein paar Leute kannte.
Wie sah Ihre Arbeit damals aus?
Ich habe zwei Spielfilme gedreht und sehr viele Dokumentarfilme. Es gab eine Arbeit, die niemanden in Kuba interessierte: Dokumentarfilme über andere Länder. Jedesmal, wenn die kubanische Regierung mit irgendeinem Land ein Abkommen unterzeichnete, wurde in Kuba eine Dokumentation über das Land gedreht. Das war aber nichts für Filmemacher, und da ich eine Art politischer Flüchtling war, überließ man es mir. Ich machte dies lange Jahre, reiste in den Mittleren Osten, nach Afrika, Sibirien, ein Jahr lang war ich in Nicaragua. Eines der Bücher, die ich noch schreiben möchte, heißt Fragmente einer endlosen Reise, es sind die Geschichten dieser Reisen.
War es leicht für Sie zu reisen? Politisch waren Sie ja nicht sehr vertrauenswürdig.
Ich wollte Kuba nicht verlassen, und die Arbeit, die niemanden interessierte, begeisterte mich. Bis ich einen Film drehte, einen langen Dokumentarfilm, der Fünfundfünfzig Brüder hieß. 1978 kam eine Brigade nach Kuba, mit Kindern von Exilanten, die 1959 das Land verlassen hatten. Ich sollte eine zehnminütige Reportage machen, aber diese Menschen beeindruckten mich so sehr, dass ich ihnen in den drei Wochen, die sie in Kuba verbrachten, überallhin folgte und eine achtzigminütige Dokumentation drehte. Das war meine Wiedergeburt in Kuba, der Film hatte ebenso großen Erfolg wie ein Spielfilm, die Leute waren begeistert und er gewann internationale Preise. Allein der Titel war eine Bombe in Kuba, diejenigen, die gegangen waren, waren gusanos, Vaterlandsverräter. Es war das erste Mal, dass jemand aufzeigte, dass das Land zweigeteilt war, die Leute weinten im Kino. So wurde ich als Dokumentarfilmer sehr bekannt. Seitdem ich Kuba verlassen habe, habe ich aber nur noch ein paar Drehbücher geschrieben.
Warum haben Sie Kuba verlassen?
Ich war von den Erfahrungen mit der Revolution sehr enttäuscht. Alles war in eine furchtbare Diktatur gemündet, gegen die ich mich entschieden stellte. Doch wusste ich nicht, was ich tun sollte. Ich hatte große Angst, wollte nicht ins Gefängnis, aber auch nicht in Miami leben. Ich war damals nicht mehr der Jüngste, als ich das Stipendium des DAAD für Berlin erhielt, war ich fünfzig. Eigentlich wollte ich nach Kuba zurück, da meine Frau krank war und ich zwei, dann drei Kinder hatte. Ich wusste nicht, ob ich ungeschützt in der kapitalistischen Welt überleben konnte, ich glaubte es nicht und hatte große Angst. Im Februar 1992 gab es in Zürich eine Veranstaltung mit Eduardo Galeano und Erich Hackl, bei der ich einen Text las, “Die Ringe der Schlange”, in dem ich die Parole “Sozialismus oder Tod” kritisierte. Daraufhin ließ der Kulturminister Armando Hart einen offenen Brief an mich in Kuba zirkulieren, den ich aber nicht von ihm, sondern von Freunden in Kuba erhielt, in dem er mich als Vaterlandsverräter bezeichnete und meinte, ich dürfte nicht Jesús, sondern müsste Judas heißen. Wenn ich nun auf die Insel zurückgekehrt wäre, wäre ich direkt im Gefängnis gelandet. Deshalb blieb ich in Berlin.
Und Sie begannen, an der Deutschen Filmakademie zu unterrichten und schrieben Ihre letzten Romane, nun aber viel regelmäßiger.
Ja, seither habe ich vier weitere Romane geschrieben und auch regelmäßiger, denn in Kuba war das Verbot der Initialen doch sehr schwerwiegend für mich. Natürlich habe ich jetzt großen Hunger nach dem Schreiben. Doch habe ich jetzt das Problem meiner vielfachen Neigungen. Ich habe eine Neigung, Zeitschriften herauszugeben und junge Talente zu entdecken. Mit Encuentro con la cultura cubana habe ich mich verrechnet, ich dachte, dass eine alle drei Monate erscheinende Zeitschrift nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen würde. Und sie hat natürlich politische Auswirkungen, selbst wenn Encuentro kein politisches Projekt ist, hat es aufgrund der Charakteristiken Kubas politische Auswirkungen. Daher komme ich oft nicht zum Schreiben.
Da wir gerade von Encuentro sprechen – wie kam es zu der Idee, diese Zeitschrift zu publizieren?
/ dass die absolute Mehrheit nicht mit dem einverstanden ist, was geschieht. Unter ihnen gibt es Mutige, wie etwa Raúl Rivero, bis hin zu bekannten Schriftstellern und Leuten, die zum Establishment gehören, aber nicht einverstanden sind mit dem, was vor sich geht. Und ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die aus verschiedenen Gründen nicht gehen wollen, etwa weil sie dort geboren wurden. Andere wieder, da es im Exil nicht sehr einfach ist. In Deutschland erhielt ich dann viele literarische, politische oder historische Texte von Freunden. Der Dichter Eliseo Diego sagte einmal, dass er die Bücher schrieb, die er gern gelesen hätte. Und ich sagte mir, wenn es eine Zeitschrift gäbe, in der ich all das lesen könnte, so wäre genau dies die Zeitschrift, die ich gerne lesen würde. Erfinden wir sie also! Daher kam ich auch nach Spanien, denn in Deutschland war es aus sprachlichen Gründen nicht möglich, in Miami gab es zu großen politischen Druck. Hier in Madrid fand ich Verständnis, Unterstützung und auch ein wenig Geld. Aber natürlich spielt auch der Zufall eine große Rolle. In Berlin adoptierte ich einen Kubaner, der unter schwierigen Umständen sein Leben fristete. Er hat ein so interessantes Leben, dass ich ihn zum Protagonisten meines letzten Romans gemacht habe. Er hatte in der Ukraine Physik studiert, musste in Berlin aber als Informatiker arbeiten. Er hat nun das gesamte Programm von Encuentro en la red erstellt. Dank ihm haben wir unsere Internetzeitschrift gemacht, der es gelungen ist, die Kluft zwischen den Generationen zu überspringen.
Wie sind die Reaktionen auf Encuentro en la red?
Bestens. Internet ist wie geschaffen für eine Situation, wie sie in Kuba herrscht, wo es eine große Bevölkerungsgruppe auf der Insel gibt und eine kleinere über die ganze Welt verstreut. Eine Zeitung käme viel zu teuer. Das Medium hat ungemein großen Anklang, wir erhalten sehr viel Material aus Kuba selbst.
Angeblich versucht die Regierung, den Zugang teilweise zu sperren.
Das können sie nicht. Sie können zwar einzelne Anschlüsse sperren, aber Kuba ist das Land der Schelmenstreiche, weswegen die Zahl der Personen mit Internetzugang viel höher ist, als man annimmt, denn diejenigen, die damit beauftragt sind, die Anschlüsse zu kontrollieren, verkaufen sie gegen Dollar. Da es so große Nachfrage nach Information gibt, kopieren die Leute die Artikel und lassen sie zirkulieren.
Wird auch Encuentro, die Zeitschrift auf Papier, auf der Insel vertrieben?
Wir geben 4500 Exemplare heraus, von denen wir 1500 auf verschiedenen Wegen nach Kuba schicken, durch Freunde, Touristen. Diese Exemplare verschenken wir, denn unser idealer Leser ist nicht derjenige, der Dollar hat, sondern jemand, der an Information und Kultur interessiert ist. Nach Miami gehen etwa ebenso viele, dort werden sie durch Abonnements oder in Buchhandlungen abgesetzt. Die übrigen 1500 werden in der restlichen Welt verkauft. Ich habe großes Interesse daran, dass die Zeitschrift eine internationale Perspektive aufweist, denn in Europa, vor allem in Osteuropa, gibt es viele Erfahrungen, die für uns nützlich sein können.
Für Europäer ist das kubanische Exil sehr verwirrend. In seinem Buch Rapport gegen mich selbst zählt der Autor Eliseo Alberto auf zehn Seiten die Namen von Autoren, Schauspielern, Künstlern auf und die Orte, an denen sie leben. Gibt es so etwas wie ein künstlerisches Exil, das sich zu einem politischen und wirtschaftlichen gesellt?
Ich glaube, es gibt eine geografische Charakterisierung des Exils. Da ist das Exil, das sich in Miami befindet, rund eine Million Menschen, und die Diaspora im eigentlichen Sinn, jeder, der nicht in Miami lebt, ebenso etwa eine Million Menschen. Ich würde keine Unterscheidungen innerhalb des Exils treffen, denn es gibt in jeder europäischen oder lateinamerikanischen Hauptstadt eine kubanische Kolonie von einiger Bedeutung. Und in ihr gibt es Künstler, Schriftsteller, aber auch Ärzte, Ingenieure. Ich würde auch nicht zwischen einem wirtschaftlichen und politischen Exil unterscheiden, denn das kubanische Exil ist in erster Linie politisch. Kuba war nie ein Emigrationsland, ganz im Gegenteil, es war ein Land, das Emigranten aufnahm. Kuba wurde erst ab dem Jahr 1959 zu einem Land der Emigranten. Die Menschen gehen, da sie keine Hoffnung mehr haben, man kann es nicht mit dem Exil aus dem maghrebinischen Staaten hier in Spanien vergleichen, oder mit den Türken in Deutschland oder mit den Bewohnern der osteuropäischen Länder. Das Tragische daran ist, dass das Exil eine Elite ist, denn diejenigen, die es wagen, Kuba zu verlassen, sind normalerweise die Fähigsten.
Wie sehen Sie die Zukunft Kubas?
Das hängt ganz von den Kubanern ab. Es hängt nur von einem Umstand ab, nämlich davon, dass kein Blut fließt. Wenn kein Blut fließt und es keine Gewalt gibt, bin ich sehr optimistisch.
Aber viele Menschen in Kuba haben doch große Angst vor den Kubanern aus Miami, die ein System wie vor 1959 einführen und die Insel den US-Amerikanern ausliefern wollen.
Das sind unsinnige Gerüchte. Vierzig Jahre vergehen für niemanden umsonst. Wäre es doch möglich! In Kuba gab es vor 1959 jede Menge kubanischer Firmen, kubanisches Kapital. Ich glaube, dass eine der größten Stärken des zukünftigen Kuba, vielleicht die größte, gerade in Miami liegt. Um es an einem Vergleich zu zeigen: was ist der Unterschied zwischen Kuba und Bulgarien? Eine Million Kubaner im Süden Floridas zu haben, 45 Flugminuten von der Insel entfernt, mit einem beachtlichen Wirtschaftspotenzial ist ein Geschenk der Götter. Ein sehr kleiner Prozentsatz, fünf, vielleicht drei Prozent, wird zurückkommen. Die meisten werden aber, so oft sie können, nach Kuba fliegen. Diese Angst vor der Vergangenheit ist eine Schauergeschichte Castros, um den Leuten Angst zu machen. Wenn diese Barriere einmal fallen wird, wird es viele Investitionen geben, viele Leute haben kleine Betriebe in Miami und können mit ihrer Familie Filialen in Kuba gründen. Andererseits liegt für mich die Zukunft Kubas in der NAFTA. Ich bin überzeugt, wenn es Frieden gibt, wird Miami in zwei Generationen eine Kolonie Kubas sein. Havanna ist eine Stadt mit einer fünfhundertjährigen Geschichte und einer Mischung aus verschiedenen Rassen und Kulturen, die so mächtig ist, das Miami nicht einmal davon träumen kann.
Miami ist aber heute doch die wirtschaftliche Metropole.
Ja, doch was heißt das schon? Warum können nicht zwei Banken und drei aggressive Investoren beschließen, einen riesigen Flughafen mitten auf der Insel zu errichten, der als Verbindungsachse zwischen Europa und Amerika dient? Kuba war seit jeher die Verbindungsachse zwischen Europa und Amerika, und wenn es diese Funktion verloren hat, die nun Miami wahrnimmt, so ist es wegen Castro. Doch heißt das nicht, dass es immer so bleiben muss. Außerdem sind die kubanischen Strände den Stränden in Florida unendlich überlegen.
Aber besteht nicht die Gefahr, dass Kuba zu einem bloßen Tourismusland wird?
Was soll daran schlecht sein? Das Problem ist, wie man dies handhabt. Natürlich ist das ein politisches Problem. Der Tourismus per se ist unvermeidlich, und er ist es auch heute in Kuba. Aber es ist ein viertklassiger Tourismus mit niedrigen Preisen, schlecht verwaltet und mit Huren als Hauptattraktion.
Was geschieht aber, wenn dabei ganze Regionen und Naturlandschaften zerstört werden, wie es etwa in Spanien der Fall ist, wo auch unter einer Diktatur mit dem Ausbau des Tourismus begonnen wurde?
Es ist ein politisches Problem und es hängt von uns ab, ob wir eine entsprechende Politik entwickeln können. Es kann natürlich eine zerstörerische Tourismusindustrie ihr Unwesen treiben, wie es jetzt der Fall ist, die ökologischen Schäden sind ungeheuer. Ist der Tourismus an sich schlecht? Ich glaube nicht. Ist er gut? Wer weiß. Allerdings frage ich mich auch, warum es denn nicht etwa high technology und Internet sein kann? Durch Encuentro en la red habe ich eine Menge junger kubanischer Informatiker kennen gelernt, die außerordentliches Talent haben.
Kuba verfügt auch noch über ein anderes sehr wichtiges Potenzial, nämlich seine Kultur, die gerade an einem Höhepunkt angelangt zu sein scheint.
In Zukunft wird es noch viel höher hinaufgehen. Castro versuchte alles mögliche, um die kubanische Musik zu liquidieren, es gelang ihm aber nicht.
Wie erklären Sie sich diesen Boom in Europa, sowohl in der Literatur als auch in der Musik? Spielt dabei der politische und kulturelle Exotismus Kubas eine Rolle?
Hier treffen viele Faktoren zusammen. Zumindest seit 1959 hat es immer einen Kubaboom in Europa und in der Welt gegeben, als die Welt beschloss, dass die Utopie in Kuba wahr geworden ist. Und so kam es zu diesem kulturellen Boom, der mir einerseits richtig erscheint, andererseits wieder ein Phänomen des Marktes ist. Und ich glaube, dass dieser Boom nicht bis auf den Grund unserer Kultur vordringt, dass sehr viel Exotismus dabei im Spiel ist, eine Art von Nostalgie, wenn diese alten Herren so gut spielen können. Ich glaube, dass auch in der Musik die Mischung von Vorteil für Kuba ist, gerade im Austausch mit der westlichen entwickelt sich die kubanische Musik weiter. Es gibt keine Folklore. Was heißt denn Folklore? Sich immer wiederholen, es so gut zu machen wie dein Vater, dein Großvater. In Kuba ist es genau umgekehrt, jede Generation hat ihre eigene Musik, die ganz anders klingt, ihre Sänger, ihren Stil. Es ist eine sich immer wieder erneuernde Geschichte. Und ich glaube, dass dabei die Diaspora eine unschätzbare Bereicherung für die kubanische Kultur ist. Es gibt nicht viele Kulturen, die so eng und so gut mit anderen zusammengelebt haben.
Es gibt sicherlich Parallelen mit den Exilanten, die vor dem Faschismus aus Europa flohen.
Ja, aber in ihrer Heimat wurde ihnen dann später kaum Aufmerksamkeit geschenkt, vor allem im Fall Spaniens. Das ist eine Lektion, aus der wir viel lernen können, nämlich wie wir nach dem Fall Castros den aktiven Austausch mit den auf der ganzen Welt lebenden Kubanern möglich machen.
Glauben Sie, dass Sie auf die Insel zurückkehren können, solange Castro noch lebt?
Das ist wohl sehr schwierig. Doch glaube ich nicht, dass man fatalistisch auf Castros Tod warten muss, ich glaube aber auch nicht an die Gewalt. Wir müssen so arbeiten, als wäre Castro schon gestorben, man muss frei denken und diese eine Obsession überwinden, um für eine Zukunft vorbereitet zu sein, die schon morgen beginnen kann. Hemingway sagte einmal, er hoffe, dass die Inspiration ihn überkomme, wenn er gerade arbeite. Dasselbe sage ich für die Demokratie in Kuba: arbeiten wir schon heute für sie. Wenn ich jetzt leide und warte, bis Castro stirbt oder die Macht abgibt, dann habe ich schon verloren. Denn es gibt viele Dinge, die man jetzt schon machen kann, sehr viele.
Published 3 August 2001
Original in Spanish
Translated by
Georg Pichler
Contributed by Wespennest © Wespennest Eurozine
PDF/PRINTNewsletter
Subscribe to know what’s worth thinking about.