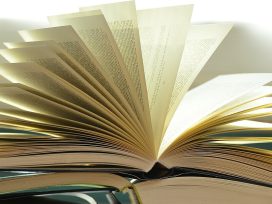
Growing reluctance to engage with books is endangering democracy and science. Deep reading boosts the human capacity for abstract and analytical thinking, protecting us from the corrosive effects of bias, prejudice and conspiracy theories.
Es gibt einen 16mm-Streifen des ehemaligen Instituts für den Wissenschaftlichen Film in Göttingen, da sitzt im Jahr 1965 der Historiker Gerhard Ritter, geboren 1888, vor der Kamera und berichtet über sein wissenschaftliches Selbstverständnis. Eigentlich hatte er das gar nicht gewollt. “Ein Professor”, so schrieb er vorab an das Institut, “soll durch seine Schriften wirken, die für sich selbst sprechen müssen, nicht aber sich selbst gewissermaßen auf die Bühne stellen und vor unbekannten und unsichtbaren Betrachtern produzieren. Das Persönliche ist unwichtig, das wissenschaftliche Werk allein wichtig. So möchte ich Sie bitten, von meiner Person doch lieber abzusehen.” Er ließ sich aber überreden, um im Film vor den betriebsamen Handwerkern seiner Zunft zu warnen, die “mit sehr leichtem Gepäck von Gelehrsamkeit” die Meister des Faches verdrängten, sich in brillanten Formulierungen versuchten, aber Tendenzhistorie produzierten.1

Max Weber auf den Lauensteiner Kulturtagen 1917, im Hintergrund Ernst Toller. Im selben Jahr hielt Weber seinen berühmt gewordenen Vortrag “Wissenschaft als Beruf” in München. Source:Wikimedia
Da sprach einer der mächtigsten Vertreter der alten, überschaubaren Ordinarienuniversität mit ihren sorgfältig kontrollierten Aufstiegspfaden in einer Zeit der Hochschulexpansion und Politisierung des Wissenschaftsbetriebs, umgeben von immer mehr jüngeren Kollegen mit anderen Fragestellungen und anderem Habitus. Und wie sein Auftritt, die ganze performance, seine Worte unterstreicht! Als ich den Film das erste Mal sah, wurde er noch von einem klappernden Projektor abgespielt, die Ränder des Bilds unscharf, auf dem Bild Verunreinigungen durch Kratzer und Haare, alles in schwarzweiß. Ritter sieht unbehaglich aus, wie er vor der Kamera sitzt, er liest seinen Text hölzern vom Papier ab, unterdessen fällt ihm ein Blatt zu Boden. Weniger medienversiert geht es kaum, und so vermittelte der Auftritt die Botschaft, es habe gar kein Auftritt stattgefunden. Das “Ich” sollte ausradiert, der Körper a-präsent sein. Richtig gelungen ist das nicht, denn gerade in seiner Unbehaglichkeit war der Körper Ritters nur zu präsent. Seiner performance eignete deshalb etwas Paradoxes. Er negierte verbal ihre Relevanz, sein Körper schien diese Dethematisierung zu unterstreichen – und hob sie doch erst richtig ins Licht. Denn eines hat die Performanzforschung klar gemacht: Wo ein Körper ist, da ist ein Auftritt.
Interessanterweise hat das in der Wissenschaftssoziologie bislang keine Spuren hinterlassen. Ist Max Weber nach wie vor zu mächtig? In seinem Vortrag Wissenschaft als Beruf (1919) hatte er “Persönlichkeit” allein denjenigen zugesprochen, die rein der Sache dienten, seien es Wissenschaftler oder Künstler, und er hatte gegen denjenigen Typus gewettert, “der als Impresario der Sache, der er sich hingeben sollte, mit auf die Bühne tritt, der sich durch ‘Erleben’ legitimieren möchte und fragt: Wie beweise ich, daß ich etwas anderes bin als nur ein ‘Fachmann’, wie mache ich es, daß ich, in der Form oder in der Sache, etwas sage, das so noch keiner gesagt hat wie ich? … – statt daß ihn die innere Hingabe an die Aufgabe und nur an sie auf die Höhe und zu der Würde der Sache emporhöbe, der er zu dienen vorgibt.”
In seinem Geist beklagen Autoren wie Peter Schöttler oder Jürgen Kaube noch heute eine “autobiographische Versuchung”, eine “völlig naive, aber deshalb nicht weniger problematische Selbstinszenierung” in “jenen, manchmal geradezu lachhaften, Vorworten, Nachworten und Danksagungen”,2 in denen die Wichtigkeit des Themas mit der Wichtigkeit der Autorperson begründet werde: Das Thema bedurfte meiner Geburt, zitiert Schöttler eine amerikanische Historikerin. “Ich” rufen, um die immer knappere Aufmerksamkeit der Leser zu erheischen, Interviews statt Forschung, als bequemer Weg, sich zu vermarkten, das, so Kaube, gefährde zunehmend die wissenschaftliche Objektivität.3 Da passt es, wenn die Medien Wissenschaftler zu Helden der Gegenwart stilisieren, etwa Götz Aly zum Joschka Fischer der Historiker.4
Aber stimmt diese Kritik: Die quatschen mittlerweile viel zu viel von sich selbst, diese Wissenschaftler? Oder gilt nach wie vor das Diktum “Von uns selber schweigen wir”, obwohl wir nun ständig über uns reden? Soziologen wie Logan Wilson, Jacques Barzun oder Martin Kohli haben da, seit den 1940er Jahren, eher eine “Schweigepflicht” ausgemacht, die sich Wissenschaftler seit langem auferlegten. Dieses Schweigen, so Kohli, sei in der Frühen Neuzeit eine notwendige Voraussetzung gewesen, die Wissenschaft von der Autorität der Religion oder dem sozialen Stand einer Person zu befreien; wissenschaftliche Aussagen sollten allein aus Wahrheitsgründen Gültigkeit besitzen.5 Es entstand der “Vf.”, eine eigentümliche Subjektform, die in mühsamen Prozessen antrainiert werden musste. Es war zu lernen, den Grat zwischen einem zu aufdringlichen “Ich” und einem zu unbekannten “Autor” zu gehen, und der Vf. ist die Markierung des Lernerfolgs: Irgendjemand hat sich erfolgreich zu einem individuellen und zugleich depersonalisierten Verfasser geformt. Er verbürgt durch seine Reputation, dass seine Texte valide und weiterführend sind, doch seine Person hält er heraus. Der Vf. verfasst ein Werk, macht sich stilistisch durch Selbstauslöschung zu einem distanzierten Erzähler, beglaubigt dadurch die Objektivität seines Texts, der jedoch nur dank eines Autornamens tatsächlich Bedeutung gewinnt.6
Diese Vorstellung führte einem Weber und einem Ritter die Feder, und ihren Nachhall findet sie im Unbehagen Schöttlers und Kaubes. Das autobiografische Reden von Individuen scheint das Institut des Vf. zu bedrohen. Dabei schweigen sie ja nach wie vor – selbst wenn sie tatsächlich ihr Ego immer mehr in den Vordergrund rücken. Was sie übergehen, das ist der Alltag im Wissenschaftsbetrieb, die Aushandlung widerstreitender Interessen in Instituten, die Überwachung impliziter Normen, der subtile Aufbau von Hierarchien oder die Semiotik von Kleidung, Gesten und Körperhaltungen. Gerade das aber, so behaupte ich, spielt eine entscheidende Rolle für die Genese wissenschaftlicher Erkenntnis. Für Wissenschaftssoziologen sprechen Wissenschaftler also nicht zu viel, sondern falsch über sich.
Mit Bill Clinton könnte man behaupten: “It’s the performance, stupid.” Das stimmt in einer Richtung natürlich nicht, weil der Wissenschaftsbetrieb die reinen Performer ohne jede inhaltliche Qualität rasch ausstößt. Doch andersherum macht die These Sinn: Ohne Performanz hat inhaltliche Qualität kaum Chancen. Das lässt sich durch mehrere Theorieentwicklungen der letzten Jahrzehnte untermauern, die ich zumindest anreißen möchte. Ausgangspunkt ist die Beobachtung Michel Foucaults, dass ein “Statut” des Sprechers eine der entscheidenden Bedingungen ist, damit sich Aussagen “im Wahren” befinden. Das Wort, “sein Wert, seine Wirksamkeit … und auf allgemeine Weise seine Existenz … sind nicht ablösbar von der durch einen Status definierten Persönlichkeit, die das Recht hat, es zu artikulieren”.7
Daran lassen sich die Erkenntnisse der jüngeren Subjektivierungsforschung anschließen, dass Menschen sich in komplexen sozialen Prozessen zu Subjekten bilden und gebildet werden, während Praxeologen untersuchen, wie Individuen in tätig körperlich-kognitiver Auseinandersetzung mit der sozialen Welt, durch Imitation, Wiederholung, Aneignung und Varianz von Verhaltensmustern, feldspezifische Praktiken regelrecht inkorporieren. So mutieren sie von Novizen zu Mitspielern eines Felds, deren Teilnehmer sich als spezifische Subjekte adressieren und anerkennen. Entscheidend ist, dass wir es in dieser Perspektive weder mit determinierten noch mit autonomen Individuen zu tun haben. Vielmehr entsteht kompetente Handlungsträgerschaft prozesshaft in der Einheit von Sequentialität (Formatierung), Situativität (Kontingenz) und Überschreitung (Kreativität), die nur innerhalb einer geteilten feldspezifischen Praktik im konkreten Vollzug entstehen kann.8
Performanz ist Teil dieser Einheit; der Begriff bezeichnet ein komplexes Verhalten, soziale Beziehungen herzustellen. Wir “inszenieren unser Handeln, Sprechen und Interagieren, indem wir es für uns und andere mit Deutungs- und Regieanweisungen versehen”,9 und unterliegen dabei dem Zwang, zu erkennen, was vorgeht, und zu erkennen zu geben, wie wir selbst vorgehen werden. Kleidung, Gestik, Körperhaltung, Mimik, Stimmlage, Blickkontakte, ein Gefühl für timing, für Hierarchien usw. werden stilisiert und moduliert, um Zugehörigkeit zu demonstrieren oder eine Botschaft zu transportieren; jeder prüft mit einem ganzen Arsenal diagnostischer Methoden unablässig die anderen, um Sinn auszumachen und Glaubwürdigkeit zu testen. Auch Wissenschaftler performen deshalb Wissenschaft, das heißt sie vollziehen sie im täglichen Auftritt. Die erfolgreiche Performanz signalisiert Zugehörigkeit, und Zugehörigkeit stimuliert Gehörtwerden.
Im Text tritt der Wissenschaftler als hinreichend depersonalisierter Vf. auf, im Theater des Betriebsalltags als hinreichend präsentes Individuum. So, und nur so, kann er das Statut erlangen, Aussagen als wissenschaftliche Aussagen zu implementieren. “Wissen wird also erst zu Wissen, indem es qua Darstellung und Inszenierung, Wahrnehmung und Medialität, Interaktion und Autorisation als solches zur Erscheinung kommt … Materialisierung, Verzeitlichung, Verräumlichung, Verkörperung, Verhandlung – all dies sind nicht etwa nachträgliche oder sekundäre Vorgänge, sie sind konstitutiv für die Entstehung von Wissen.”10
Als ich für diesen Beitrag Literatur recherchiert habe, bin ich schnell auf die einschlägigen Aufsätze, Sammelbände und Handbücher in den Sozialwissenschaften gestoßen. “Performativität”, “Inszenierungsgesellschaft” oder “Auftritte” lauten die Titel, und sie zielen auf alle möglichen Bereiche: Alltagsgespräche, Rituale in der Politik, mediale Inszenierungen, Gottesdienste, Tanz, Literatur, zeitgenössische Kunst, um nur einige wenige zu nennen. Für die Wissenschaft dagegen finden wir: soziologische Studien über wissenschaftliche Karrieren und wie WissenschaftlerInnen diese gefahrvollen Wege erleben; wissen(schaft)ssoziologische Einführungstexte, die vollkommen ohne Akteure auskommen; Laborstudien, die engbegrenzte Interaktionssituationen in den Blick nehmen; Evaluationen, die prüfen, ob Begutachtungsverfahren funktionieren; Biografien, die Habitus, Lebensführung und Denken beleuchten; Interviewbände, in denen Historiker ihre Arbeit am heimischen Schreibtisch beschreiben – allesamt Makroanalysen des Systems oder Einblicke in individuelle Alltagssituationen. Doch nirgendwo: Performanz. Die verbirgt sich als unausgesprochene Voraussetzung hinter farbigen Episoden oder abstrakten Analysen, wenn beispielsweise Norbert Elias erzählt, dass seine Karriere durch einen Vortrag im Salon Marianne Webers Fahrt aufnahm oder Sandra Beaufaÿs zutreffend analysiert, wie man ein Thema mit seinem Namen besetzt und mit seinem Gesicht wiedererkennbar macht.
Einer der wenigen Treffer, die wir verbuchen können, ist Dietrich Schwanitz’ Aufsatz Formen der Selbstdarstellung in der Wissenschaft. Schwanitz spricht die Bedeutung der Theatralik und ihrer Invisibilisierung an. Aber dann ist er sehr schnell bei einem beliebten Genre, das immer wieder freudige Zustimmung hervorruft: der Typisierung. Auf Kongressen und in Gremien bewegen sich seiner Beobachtung nach lauter Selbstdarsteller: “der Imponiertyp”, “der Polemiker”, “der Chaot”, “der Betroffene”, “der Inquisitor” usw. Schwanitz benennt in einer Fußnote selbst den Schwachpunkt dieses Vorgehens: “Jeder erkannte andere, niemand sich selbst.” Sein Text heischt erprobt nach Beifall statt zu analysieren. Die Karikaturen seiner Wissenschaftswelt können belacht, müssen aber nicht auf die seriöse wissenschaftliche Arbeit bezogen werden.11
Doch in Gremien, auf Tagungen, in der ganzen informellen Kommunikation wird Forschung strukturiert und gewichtet, und das kann außerordentlich persönlich werden. Das zu beschreiben scheint jedoch kein Anliegen der Soziologie oder der Wissenschaftsgeschichte zu sein. Indem sie Habitus und Handwerk untersuchen, verwenden sie auffällig kollektivierende oder isolierende Zugriffe. Ihre Akteure werden in Bezug auf ihr intellektuelles Handwerk beobachtet, nicht auf ihre persönlichen Beziehungen untereinander, die Konflikte, Machtverhältnisse und Hierarchien, die faulen Kompromisse und Intrigen, psychotischen Verhaltensweisen oder Diskriminierungen; die produktiven Gespräche in den Kaffeeküchen, die denkstilbildenden Kolloquien, die gemeinsamen Kneipenbesuche, privaten Aktivitäten, Seminarfeiern, Dienstausflüge, die zusammenschweißen oder haarfein ausgrenzen. Das zu beschreiben hieße, den Spiegel nicht allein den anderen vorzuhalten, sondern sich selbst einzugestehen, dass die Produktion von Wissen keine rein intellektuelle Sache, das Soziale nur “Beiwerk” ist, sondern dass es immer auch die eigene Identität berührt – oder gar erst konstituiert.
Das zu dekonstruieren könnte dann an die persönliche Substanz gehen. Ist das ein Grund, warum weder Subjektivierungsprozesse noch die alltägliche Performanz in der Soziologie, Wissenschaftsgeschichte und Wissenschaftstheorie Beachtung gefunden haben? Weil das Stilisieren schmerzloser ist? Ein Historiker kann nur nachts bei Pfeife und Wein schreiben, der andere streifte tagsüber durch die Kinos, Museen und Theater, spielte abends Bridge, um nachts zu arbeiten; fast so attraktiv wie diese aufregend wirkenden Künstlerleben – nur ohne deren emotional irritierende Überspanntheit.12
Performanz enthüllt sich der Wahrnehmung durch Beobachter. Sie ist flüchtig und schlägt sich deshalb nur bruchstückhaft in Quellen nieder. Man müsste sie mikroethnologisch akribisch genau protokollieren und fotografieren, man hätte Harun Farocki die Antragsphase für ein Graduiertenkolleg filmen lassen sollen, denn wenn man Wissenschaftler nur befragt, so überlässt man ihnen die Kontrolle über die Quellenproduktion und setzt sich zugleich ihrer Blindheit aus, was die eigene Performanz betrifft. So muss man sich also bislang aus unzähligen Texten, Bildern, Tonbändern und Filmen Schnipsel zusammensuchen, um performative Praktiken wenigstens in Form eines Kaleidoskops sichtbar zu machen und den Zusammenhang zwischen Subjektivierung, Performanz und Wissensproduktion plausibel zu belegen. Man muss im Grunde eine Parallelfigur entwerfen, so wie Alain Boureau das in seiner Biografie Ernst Kantorowicz’ getan hat, dessen frühes Leben in Quellen nicht greifbar war. Boureau hat Carl Schmitts “Partisanen” gewählt und den Freikorpskämpfer Kantorowicz entlang dieser Figur modelliert; wir könnten uns beispielsweise an Künstler und Schriftsteller halten, die sich seit jeher in Szene setzen, um bestimmte (öffentliche) Vorstellungen von Kunst regelrecht zu verkörpern, und deren Performanz deshalb erforscht ist.
Dem exaltierten Auftritt eines Joseph Beuys wäre der Gerhard Ritters zur Seite zu stellen, dem überspannten Stil künstlerischer Ego-Dokumente der betont sachliche wissenschaftlicher Texte, einer das Publikum emotional irritierenden performance der für die Zuhörer intellektuell nüchterne Vortrag. Performanz soll ein Bild erzeugen und damit Inhalte stabilisieren. Ein Wissenschaftler muss so “authentisch” wirken wie ein Künstler, damit seine Arbeit ernst genommen wird – wobei diese Parallelisierung natürlich nur ein Prinzip darstellt, das sich je nach Fach, Wissenschaftskultur und Epoche unterscheidet oder verändert. Es funktioniert nicht mehr, dass, wie 1882, ein Heidelberger Professor und Geheimrat in ordinarialer Herrlichkeit auf den Balkon seines Hauses tritt und Bauarbeiten mit dem Ruf “Wenn der Lärm nicht sofort aufhört, nehme ich den Ruf nach Berlin an!” unterbrechen lässt. Obwohl diese Szene vielleicht gar nicht so entfernt ist von den Auftritten eines Beuys.13
Wie sieht die Figur in ihren Umrissen aus? Sie hat – im Dienst – einen vergleichsweise immobilen Körper, der oft sitzt oder hinter einem Vortragspult steht. Mobil sind die Hände, die Gesprochenes durch wenige gestische Typen stützen: vor dem Bauch verschränkt, als Schale, mit der Handfläche verweisend oder durch Auf- und Abbewegungen unterstreichend. Körperliche Bewegungen sind gemessen, die Sprache in einer verhaltenen Tonlage. Die Figur trägt keine ausgefallene, aber immer etwas uniform wirkende Kleidung, keine Applikationen, die den Körper verändern (Tätowierungen, Piercings). In Diskussionen stellt sie eine Meinung gegen andere, provoziert aber keinen Streit; Dissens wird nicht bis zum bitteren Ende durchgefochten. Nach Vorträgen: Dank und höfliche Kritik, die intellektuelle Qualität eines Vortragenden wird in informellen Gesprächen in Frage gestellt. Emotionale Ausbrüche verstören. Pathos wirkt befremdlich, ebenso exaltierte Lobeshymnen. Die Grundhaltung ist durch Takt und Feinsinn bestimmt.
Das ist eine sehr zarte, durchscheinende Skizze, die in unterschiedlichen Varianten immer anders ausgetuscht werden muss, je nachdem, in welcher Epoche, Wissenschaftskultur oder Disziplin man sich bewegt. Man müsste einen repräsentativen Katalog performativer Akte erstellen und ihn von dem anderer Professionen konturierend abheben. Im Längsschnitt wäre zu zeigen, wie sich der spezifische Auftritt von Wissenschaftlern seit der Frühen Neuzeit herausgebildet und verändert hat, und schließlich würden mikroethnologische Studien en detail den Zusammenhang von Performanz und Wissensproduktion analysierbar machen. Die Quellenerhebung wäre allerdings schwierig. Vor allem für die Vergangenheit könnte man nur verstreute Fundstücke zusammenstellen, denn Berichte und Erinnerungen über den Wissenschaftsbetrieb haben selten diejenigen Praktiken thematisiert, auf die es uns ankommen würde. Aber auch in der Gegenwart stößt man auf Schwierigkeiten, denn befragte Wissenschaftler können ihr eigenes Verhalten kaum beschreiben – sie sehen gar keinen Sinn darin –, und ethnografisch beobachten lassen sich viele auch nicht gerne.
Wer diese Figur(en) also mit spärlichen Hilfsmitteln plastisch machen will, darf nicht bei Karikaturen landen. In diesem Sinn hat der Historiker Valentin Groebner gezeigt, wie fein man beobachten kann und muss. In einem amüsanten Vortrag hat er sich seiner Bielefelder Studienzeit erinnert, und dieser Text ist einer der wenigen, die Performanz empirisch tatsächlich in den Blick bekommen. Schon der Schreibstil der “Bielefelder Schule” war ein performativer Akt, durch den Anschlüsse hergestellt und gekappt wurden, ein Sound. “Grammatikalisch war dieser Sound getaktet von an den Satzanfang gestellten Konditional- und Relativsätzen, vom hauptwörtlich gebrauchten Verb, von Wäldern aus Gerundia und Gerundiva à la ‘es ist ein zu Klärendes’, alles Handlungsanweisungen mit verschwundenem sprechenden Subjekt.”
Bielefeld war zudem ein Layout; Texte waren, als Beweis für Empirie, mit Grafiken und Tabellen gespickt, auch in den Fußnoten. Dann der raue, unduldsame Ton im Kolloquium, in dem der Vortragende bewusst scharf angegriffen und theoretische Unterfütterung eingefordert wurde. “Theoretisch zu arbeiten hieß, bei den eigenen Vorträgen oder bei den eigenen Redebeiträgen zu den Vorträgen anderer die Namen theoretischer Schutzpatrone anzurufen, zusammen mit bestimmten Zauberworten”. – “‘Theoriegesättigt’ war ein sehr, sehr positives Attribut”, und diese Orientierung wurde bis in die Kleidung hinein visuell kommuniziert: Cordjackett, weiße Rollkragenpullover, bis an den Hals zugeknöpfte schwarze Hemden.
Viele spielten dieses Spiel, ein Rudel junger, hungriger Wölfe, die hinter ihren Leitwölfen Jagd machten auf Kulturhistoriker, Theorieabstinenzler und Preußenverehrer – während Groebner zu Hause, bei den Assistenten, die chromglänzenden Alessi-Wasserkessel entdeckte, ein “buntes hedonistisches Küchengeglitzer italienischer Provenienz” als “Versprechen auf Eleganz und, so scheint es mir im Nachhinein, auf all das, was Kocka und Wehler als bunte kulturalistische Verlockung kritisierten”.14
Sehr dicht sind auch die Erinnerungen des Literaturwissenschaftlers Uwe Pörksen an das erste Jahr des Wissenschaftskollegs zu Berlin, des Camelot im Grunewald15 In seinem Buch entsteht ein ganz eigentümlicher Kosmos. Große Namen sind als Kollegiaten geladen, sie begegnen einander und parlieren, über welche großen Namen sie forschen, ob sie ihre Forschungen an Goethe oder Nietzsche anschließen. Sie nehmen ihre Umwelt wahr, indem sie sie als Gestaltung durch Dichter und Denker imaginieren, in Romanfiguren vergleichen sie einander; ein Leben in Zitaten und Anspielungen: “‘Grüßen Sie die feine Schwäbin’, sagt Hans Egon Holthusen, wenn ich für ein paar Tage nach Freiburg fahre. Ein sehr sympathisches Zitat. Gottfried Keller hat von Mörike gesagt, er sei der ‘Sohn des Horaz und einer feinen Schwäbin’.” Lebenskrisen und Alltagssituationen sind ohne Verweise auf die Titanen der Geistesgeschichte offenbar kaum zu bewältigen. In den Diskussionen, bei den Mahlzeiten, auf Spaziergängen vergemeinschaften sich die Kollegiaten über einen Kanon an Literatur und erprobten Umgangsformen, ein “einigender Assoziationsraum”16 (nur einer hat sich sofort in sein Zimmer zurückgezogen und bildet fortan eine interessante Leerstelle im Buch – denn er tat, was Ritter als Ideal der Wissenschaft postuliert hatte: forschen).
Es ist eine Welt, die fast wie abgekoppelt wirkt von den nichtakademischen Teilen der Realität und in der sich die Kollegiaten selbst Impulse schenken. Sie lassen sich gegenseitig anregen oder irritieren; was irgendwie vertraut erscheint, wird in die eigenen Gedanken eingefügt, zu Befremdliches, weil es “kein richtiges Kollegthema” ist, unwillig und ohne Diskussion ad acta gelegt (Helga Nowotnys Vortrag Wie männlich ist die Wissenschaft?), oder es ruft aggressives Unverständnis hervor wie Ivan Illichs Geschichte der Knappheit. Zumeist aber lässt Pörksen sie alle liebenswürdig und vergnügt sein, sie lachen viel und verbrüdern sich bei fröhlichen Festen, lassen sich von sizilianischen Musikern bis in den Morgen zum Tanz aufspielen. “Hauptsache lustig.” Zu Tisch – vom Personal “König Artus und seine Tafelrunde” genannt – ist Sakko zu tragen, nicht Pullover; dort “ist, was Wapnewski sagt, immer hochgetrieben, zugespitzt. Jedes Zusammensein ist ein Anlass, etwas Geistreiches schnell zu platzieren.” Man bittet, “Ihnen etwas vor die Tür legen” zu dürfen: “Bringen Sie es mir doch gleich. Lesen Sie mir etwas vor, wenn Sie mögen.” Einem, Gershom Scholem, wird am Ende eine Ausstellung gewidmet. Dem Text lässt sich regelrecht ein Habitus ablesen. Den Kollegiaten eignet nichts Unvornehmes, weder geistig noch körperlich. Sie feiern ausgelassen, aber sie lassen sich nie gehen, auch betrunken nicht, trinken Mengen an Alkohol, jedoch Wein. Jeder wird daran gemessen, ob er in diesen Kreis einzuschmelzen in der Lage ist.
Groebner hat eine ironische Distanz zum mittlerweile entschwundenen “Bielefeld” zelebriert, Pörksen taucht im Rückblick Hals über Kopf in eine verlorene Welt ein. Sein Text macht Performanz sichtbar, seine Sprache bildet die besondere Atmosphäre deshalb überaus plastisch (und zustimmend) nach, zugleich aber reproduziert er diese männliche Form der wissenschaftlichen Vergemeinschaftung. Insoweit ist sein Text selbst performativ. Den Blick von außen verliert Pörksen jedoch nicht ganz, vielleicht, weil er seine Tagebuchaufzeichnungen sprechen lässt, statt sie ex post in geglättete Erinnerungen zu transformieren. Deshalb kann man sich seinen eigenen Reim auf all die Merk-Würdigkeiten machen. Wie die Bielefelder verkörperten die Grunewäldler markant die Notwendigkeit, Wissenschaft in der Performanz zu leben und zu vollziehen, und damit Ihresgleichen ein- und die anderen vornehm-stillschweigend auszuschließen.
In “Camelot” passierte genau das, was Sibylle Peters für das Institut des Vortrags herausgearbeitet hat. Einer der Kollegiaten verwandelte sich jeweils “in einen body of evidence, an dem Körperzeichen als Zeichen eines Denkens in Aktion ablesbar werden, das als (mit-)geteilter Prozess der Erkenntnis den Zeugen in neuer Weise involviert”; die übrigen versammelten sich “nicht allein im Auditorium”, sondern “als Auditorium: als ein soziales Gefüge, das als solches erst den Resonanzraum bereitstellt, von dessen Aufnahme her das Wort des vortragenden Philosophen seine Bedeutung erhält”. Das konstituierte eine tägliche kollektive Aufführung, in der verhandelt wurde, “wer Träger und Teilhaber von Wissen ist, wer die Autorität des Wissens verkörpert und welche Körperschaft des Wissens diese Autorität verleiht”.
Eine naheliegende Quelle, wenn man Performanz erschließen will, sind Bilder. Es gibt Bildsammlungen in den Archiven mit eher schnappschussartigen Aufnahmen, die oft zur Illustration von Biografien und Autobiografien herangezogen werden. Und es gibt Bildbände, in denen Wissenschaftler von professionellen Fotografen beobachtet werden, wie etwa jener Band Günter Berschs über Mitglieder der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Dafür ließen sich 15 Wissenschaftler kunstvoll in Szene setzen. Andere hatten dieses Ansinnen von vornherein abgelehnt, einige zogen ihre Zustimmung zurück, nachdem sie die Bilder sahen: zu kunstvoll, zu indiskret, wieder andere “kannten sich schöner”. Die 15 Verbliebenen sind an ihren akademischen Wirkungsstätten, in den Privatwohnungen, in bildungsbürgerlich konnotierten Umgebungen oder im urbanen Raum aufgenommen. Im Hintergrund sieht man Büsten von den Größen der jeweiligen Fächer und Bücherwände; die Körperhaltung variiert zwischen Stehen, Sitzen und Schreiten sowie der der Profession geschuldeten Denkerhaltung. Der Blick richtet sich auf Bildschirme, Texte und Diskussionspartner oder schweift, meistens gedankenversunken, in die Umwelt. Er hat immer etwas Gutachtendes oder geistig in sich Versunkenes (von den direkten Blicken in die Kamera abgesehen).
Den Fotografien sind schriftliche Porträts der Abgebildeten durch Kollegen beigefügt. Diese Texte handeln von der intellektuellen Arbeit, bildungsbürgerlichen Tätigkeiten und der Fähigkeit, das Leben bei einer Flasche Wein und gutem Essen zu genießen. Bei den Frauen spielen Kochkünste und der Einsatz für andere (Frauen) eine gewisse Rolle, bei Männern ist es tendenziell stärker das Intellektuelle. In kurzen Lebensläufen werden geballt Rufe, Erfolge und internationale Auszeichnungen aller Porträtierten aufgelistet, die Insignien wissenschaftlicher Bedeutung, in den Porträts werden sie, manchmal geradezu hymnisch, als vielseitige, neugierige Grenzgänger gezeichnet, die sich eher gegen einen molochartigen Wissenschaftsbetrieb behaupten als dessen Teil zu sein.
Insoweit folgen die Lobpreisungen den üblichen Genreregeln (die Betonung hedonistischer Qualitäten ist zweifellos dem 21. Jahrhundert geschuldet, das auch an der Wissenschaft nicht spurlos vorbeischrammt), während die Tatsache, dass sich Wissenschaftler für eine Publikation von einem Künstler haben ablichten lassen, weniger üblich ist. Trotzdem ist die Art der Darstellung erprobt. Sie überhöht in puristischen Schwarzweißfotografien und lobpreisenden Ehrungen den Habitus des seriösen Wissenschaftlers, der geistig nicht verengt ist, der Wissenschaftler ist und nicht Funktionär des Wissenschaftsbetriebs, der nicht allein Wissenschaftler, sondern auch “Mensch” ist, dem Leben und der Kunst zugetan.17
Solche Publikationen sind also gute Quellen, um Performanz herauszulesen und zu beobachten. Sie stellen überdies selbst einen performativen Akt dar. Sie stilisieren ein bestimmtes Milieu, und diese Stilisierung reguliert die Kommunikation unter Ihresgleichen wie nach außen. Zugleich bleibt verschleiert, wie die Mitglieder des Milieus im ganz normalen Alltagsbetrieb ihrer Profession funktionieren, wie sie durch deren Zu- und Anmutungen geprägt sind und sie perpetuieren. Und sie transportieren zumeist einen männlichen Blick. Natürlich tauchen in Erinnerungen wie denen Pörksens Frauen als kluge und anregende Geschöpfe auf, und trotzdem bleiben sie merkwürdig a-präsent, sie leben nicht wirklich in der Wissenschaftswelt der Männer.
Zu Tisch in “Camelot” trägt man Sakko, nicht Pullover: Über die Kleidung der Frauen wird kein Wort verloren. Dass Pörksen immerhin erwähnt, auf wie wenig Widerhall Helga Nowotnys Vortrag über die männliche Wissenschaft stieß, dürfte der rückblickenden Perspektive geschuldet sein. Nach einigen Jahrzehnten feministischer Debatte gehört es sich auch für Männer, darüber einige kritische Worte zu verlieren. Die Differenz bleibt. Nowotnys Thema verstörte niemanden, es war einfach nicht relevant. Illich erzeugte Tumult, er hatte das intellektuelle Selbstverständnis der Teilnehmer berührt. Tauchen Frauen in vielen Quellen deshalb nicht auf, weil sie (damals) tatsächlich seltener im Wissenschaftsbetrieb vertreten waren – oder weil die Performanz von Wissenschaftlern unausgesprochen eine derart männliche Perspektive festschrieb, dass Frauen einfach nicht wahrgenommen wurden? Es gibt den Bericht eines erfolgreichen Wirtschaftswissenschaftlers, der nach einer Geschlechtsumwandlung erschüttert feststellen musste, dass sie auf Tagungen plötzlich kein Gehör mehr fand. In den vielen Quellen entsteht ein implizites Bild, das Frauen auf ganz subtile Weise aus der Wissenschaft ausschließt – es macht sie, ohne jede böse Absicht, unsichtbar.
Performanz ist also eine Oberfläche, die tiefgehende Wirkungen hat, die jedoch intransparent gemacht werden. Wenn es keinen Auftritt mehr zu geben scheint, sind wissenschaftliche Ergebnisse nicht durch Subjektivität kontaminiert, wirkt die Hierarchisierung von Sprechern nicht delegitimierend und ist der Ausschluss von Frauen und deren Perspektiven auf die Welt eine “natürliche” Gegebenheit. In der Oberfläche der Darstellung wird also eine Tiefe des Sozialen sichtbar. Performanz konstituiert Wissen, Nichtperformanz legitimiert unsichtbar ihren Zuschnitt. Diese eigentümliche Form des “Nicht”/Auftretens müssen WissenschaftlerInnen lernen, um im Feld der Wissenschaft bestehen zu können.
Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen: Filmdokumente zur Zeitgeschichte. G 106/1967: Gerhard Ritter, Freiburg i.Br. 1966. Beiheft, Göttingen 1967.
Peter Schöttler, Die autobiographische Versuchung. In: Alf Lüdtke/Reiner Prass (Hrsg.), Gelehrtenleben. Wissenschaftspraxis in der Neuzeit. Köln: Böhlau 2008.
FAZ vom 9. September 2008.
Christoph Amend in Zeit vom 1. Juli 2004.
Martin Kohli, "Von uns selber schweigen wir". Wissenschaftsgeschichte aus Lebensgeschichten. In: Wolf Lepenies (Hrsg.), Geschichte der Soziologie. Studien zur kognitiven, sozialen und historischen Identität einer Disziplin. Bd. 1. Frankfurt: Suhrkamp 1981.
Thomas Etzemüller, Der "Vf." als biographisches Paradox. Wie wird man zum "Wissenschaftler" und (wie) lässt sich das beobachten? In: Thomas Alkemeyer/Gunilla Budde/Dagmar Freist (Hrsg.), Selbst-Bildungen. Soziale und kulturelle Praktiken der Subjektivierung. Bielefeld: transcript 2013.
Michel Foucault, Archäologie des Wissens. Frankfurt: Suhrkamp 1992.
Vgl. Thomas Alkemeyer/Nikolaus Buschmann, Praktiken der Subjektivierung -- Subjektivierung als Praxis. In: Hilmar Schäfer (Hrsg.), Praxistheorie. Ein soziologisches Forschungsprogramm. Bielefeld: transcript 2015.
Hans-Georg Soeffner zit. n. Herbert Willems, Inszenierungsgesellschaft? Zum Theater als Modell, zur Theatralität von Praxis. In: Ders./Martin Jurga (Hrsg.), Inszenierungsgesellschaft. Ein einführendes Handbuch. Opladen: Westdeutscher Verlag 1998.
Sibylle Peters, Der Vortrag als Performance. Bielefeld: transcript 2011.
Dietrich Schwanitz, Alazon und Eiron. Formen der Selbstdarstellung in der Wissenschaft. In: Herbert Willems/Martin Jurga (Hrsg.), Inszenierungsgesellschaft.
Alexander Kraus/Birte Kohtz, Geschichte als Passion. Über das Entdecken und Erzählen der Vergangenheit. Zehn Gespräche. Frankfurt: Campus 2011.
Jürgen Kaube, Max Weber. Ein Leben zwischen den Epochen. Berlin: Rowohlt 2014.
Valentin Groebner, Theoriegesättigt. Ankommen in Bielefeld 1989. In: Sonja Asal/Stephan Schlak, (Hrsg.), Was war Bielefeld? Eine ideengeschichtliche Nachfrage. Göttingen: Wallstein 2009.
Uwe Pörksen, Camelot im Grunewald. Szenen aus dem intellektuellen Leben der achtziger Jahre. München: Beck 2014.
Peter Wapnewski, Mit dem anderen Auge. Erinnerungen 1922-2000. Berlin: Berlin Verlag 2007.
Günter Bersch, ForscherLeben. Akademiemitglieder -- 15 Porträts. Berlin: Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften 2005.
Published 13 October 2015
Original in German
First published by Merkur, 10/2015
Contributed by Merkur © Thomas Etzemüller / Merkur / Eurozine
PDF/PRINTSubscribe to know what’s worth thinking about.
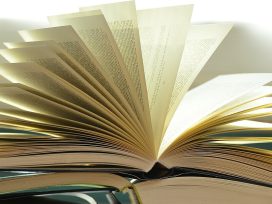
Growing reluctance to engage with books is endangering democracy and science. Deep reading boosts the human capacity for abstract and analytical thinking, protecting us from the corrosive effects of bias, prejudice and conspiracy theories.

In rekto:verso: what the body of the action hero says about relations of power; why yoga’s discourse of accessibility rings hollow; and whether fitness practitioners should really be reading Mishima.