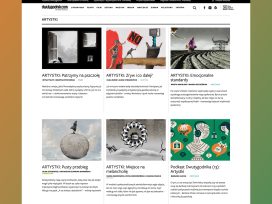Was würden Sie tun, wenn sie wüssten, sie haben nur noch ein Jahr? Diese Frage stellt uns der großartige Film “Das Beste kommt zum Schluss”. Carter und Edward begegnen sich in einem Krankenhaus, Carter, der Mechaniker und Edward, dem das Krankenhaus gehört, treffen sich, als sie beide die Diagnose erhalten, dass sie nur noch ein Jahr zu leben haben. Das ungleiche Paar beschließt in den verbleibenden Monaten genau die Dinge zu tun, die es immer schon tun wollte. Sie beginnen zu leben, wie sie noch nie gelebt haben. Mit Leidenschaft, mit Leichtigkeit mit Humor und echter Tiefe. Sie bilden eine liebevolle Schicksalsgemeinschaft, hassen sich mitunter und kommen doch immer wieder ganz nah zueinander. Jack Nicholson und Morgan Freeman spielen die Tragikkomödie so brillant, dass man sich wünschen möchte, selbst so intensiv leben zu können, um so eine wunderbare Liste der letzten Dinge aufstellen zu können. Auch wenn einem noch mehr Zeit bleibt als ein Jahr.
Wer lebt stirbt auch. Oder: Wer nicht stirbt, lebt nicht. Der Tod gehört zum Leben. Schaut man sich aber zeitgenössische Lebensideale und Lebensentwürfe an, dann entsteht oft eher der Eindruck, als würde die Tatsache dass der Tod zum Leben dazu gehört mit aller Macht verdrängt werden. Der ständige Aufruf zur Selbstverwirklichung will uns glauben machen, dass es keine Grenze gäbe, erst recht nicht die ultimative Grenze des Todes. Es geht immer weiter! In Anlehnung an Martin Heideggers Begriff der “Seinsvergessenheit” könnte man von einer “Todesvergessenheit” sprechen. Der Fetisch Jugendlichkeit ist Ausdruck dieser Vergessenheit, er verdrängt und leugnet letztlich das Ende jeder freien Wahl, den Tod. Vor der Auseinandersetzung mit unserer “Letztzeit” flüchten wir uns in die Intensitäten der immer neu anlaufenden “Jetztzeit”.
Nun könnte man aus einer philosophischen Perspektive sagen, dass sich über den Tod sowieso nur schweigen lässt, da er schlechthin unvorstellbar ist: reines, leeres Nichts. Oder Alles auf einmal. Die sogenannte Nahtoderfahrung wird von Menschen, die sie gemacht haben, immer wieder als Gang durch einen Tunnel ins unbestimmte Helle beschrieben.
Das, wovor wir wirklich Angst haben, ist gemeinhin nicht der Tod. Nein, unsere Sorge gilt dem Sterben und eben darüber wollen wir lieber nicht reden. Gleichzeitig ragt der Tod heute immer mehr ins Leben hinein. Durch moderne Medikamente und Intensivmedizin dauert das Sterben immer länger. Der Tod wird vertagt. Der Sensenmann wird wie im Bayrischen Volksstück vom “Brandner Kasper” noch einmal überredet und wieder nach Hause geschickt. Irgendwann kann er zurück kommen. Irgendwann. Wenn die allerletzte Etappe des Lebens aber immer länger dauert und so noch stärker als früher zu einem Teil des Lebens wird, dann ist es im Sinne eines bewussten Lebens wünschenswert, dass es uns gelingt, sie zu gestalten. Dass wir die Letztzeit nicht als etwas erleben, das uns nur widerfährt, sondern als etwas, dem wir bewusst und kreativ eine Form geben können und wollen. Der Tod mag uns als unvorstellbares Nichts oder vorstellbares Alles erscheinen, das Sterben, die Letztzeit des Menschen, kann nichtsdestoweniger Gegenstand unserer Sorge und Gestaltung, vielleicht sogar der Hoffnung werden. In Anlehnung an die christliche Ars moriendi des Mittelalters könnte man von einer Kultur des Sterbens sprechen. Diese setzt einerseits voraus, dass wir uns auf das Sterben vorbereiten können – der plötzliche Tod, etwa durch einen Unfall, nimmt uns durch seine traumatische Plötzlichkeit die Chance zur Gestaltung. Andererseits könnte man sagen, jeder Tag wirklichen, intensiven Lebens ist ein Tag, an dem das Sterben als Teil des Lebens vorbereitet werden kann. “Keine interessen, keine sehnsüchte. Das war der anfang vom ende. Gepanzerte selbstnichtwahrnehmung”. So schreibt Michael Lenz in seinem Prosastück Muttersterben und meint ein Leben, das ihm so wenig lebendig schien, dass der Tod schon angefangen hatte, bevor ans Sterben überhaupt zu denken war.
Sterben im Dialog
Wenn wir über eine neue Kultur des Sterbens sprechen, kann es nicht darum gehen, nostalgisch die “gute alte Zeit” zu beschwören, in der das Sterben noch im Kreise der Familie stattfand und Totenwache gehalten wurde. Trotzdem lässt sich von den Alten lernen, wenn es darum geht, dem Schreckbild aus Kabeln, Neonlicht, Desinfektionsmitteln, Bildschirmen und Maschinen etwas entgegenzusetzen. Gegen die Angst vor der Einsamkeit am Lebensende hilft es, das Sterben wieder stärker als etwas zu begreifen, das in einem sozialen Umfeld verortet und verwurzelt ist. Ganz wesentlich für eine aktiv gestaltende Kultur des Sterbens ist deshalb der Dialog, individuell, gesellschaftlich, sogar politisch. Dazu müsste der Umgang mit Tod und Sterben neu erlernt werden und die Angst, über das “Unaussprechliche” zu sprechen, überwunden werden. Ist das möglich? Ist das wohlfeil? Oft reicht ein einfaches Signal, dass man über das irgendwann Bevorstehende sprechen möchte und Eltern und Großeltern reagieren dankbar auf das Angebot. Es ist der erste Schritt aus der Einsamkeit und der Angst davor und kann für alle eine Befreiung sein. Sich im Gespräch, mit einem Gegenüber auf das Sterben vorzubereiten, bedeutet, das Sterben als einen sozialen Vorgang zu begreifen und den Menschen als ein soziales Lebewesen, auch im Sterben. Es ist vielleicht gar nicht der ehemals nächste Mensch, mit dem man das tut, aber es ist der Andere, der, in dessen Wort, Auge, Seele, ich mich spiegeln kann.
Der italienische Philosoph Giorgio Agamben hat darauf hingewiesen, dass die Situationen, in denen der Mensch auf das “bloße Leben” zurückgeworfen wird und seine personalen und sozialen Bestimmungen sozusagen vom Körper abgekappt werden, in der Moderne zugenommen haben. Der an Maschinen angeschlossene Sterbende, über den nur noch technische Automatismen entscheiden, wäre ein Beispiel für diese Isolierung des “bloßen Lebens”. Längst hat sich aber selbst im angespannten Gesundheitssystem Deutschland der Gedanke verbreitet, dass Jede/r ein Individuum mit Erinnerungen, Hoffnungen, Ängsten, auch mit Macken, einer eigenen Geschichte, mit eigenen Werten, gegebenenfalls Glauben, mit Familie, Freunden, Ratgeberinnen und einem ganz persönlichen Internet-Zugang ist. Ein Krankenhaus, das nicht auf eine mit Verstand, Herz und Blick für die kleinen Dinge eingerichtete Palliativstation verweisen kann, wird heute am “Markt” kaum bestehen können. Wer ist der Mensch, welcher Mensch ist da? Wen liebt er und wonach stehen seine Sinne? Was ist das Gefühl, das ihm die Seele trägt? Und: was ist sein Schmerz? Schmerz und Tod sind Geschwister im Sterben, wenn es nicht allzu “plötzlich und unerwartet” kommt, wie es in der Anzeige oft heißt. Schmerz ist die Bewusstwerdung der eigenen Begrenztheit, er ist die erträgliche oder unerträgliche Anschaulichmachung der eigenen Unfähigkeit, alles in der Hand zu haben, regeln zu können. Der Schmerz ist die Grundausstattung des Lebens, über das sich nicht mehr und nicht gänzlich verfügen lässt. Der Schmerz des Abschieds, der Schmerz der ausbleibenden Versöhnung, der unzumutbare, brennende, entsetzliche Körperschmerz, der alles relativiert, was je war. “Kultur des Sterbens”: das soll nicht romantisch klingen. Aber es soll darum gehen, mit dem umzugehen, was ist. Nicht wegsperren, nicht schweigen, wenn Klagen und Schreien angesagt sind. Eine neue Kultur des Sterbens wird weder Schmerz noch Schmerzen wegnehmen. Aber die Kultur des Sterbens kann etwas von Schmerz, von Verlust, von Endgültigkeit nehmen, weil sie genau hinsieht, sich eins macht sich eins macht. Und dem Sterben, der Aussicht aus das Nicht-Mehr-Sein oder das Nicht-Mehr-Hier-Sein oder Nicht-Mehr-Von-Dieser-Welt-Sein eine Form gibt, gern eine der Zeit gemäße, gern eine, die dem Leben der Großtadtsingles so entspricht wie den Alten im Bergdorf, deren Sterben “Marias letzte Reise” beschreibt, der andere große Film über das Davor des Todes.
Dialogräume schaffen: Palliativmedizin und Hospize
Palliativmedizin und Hospiz eröffnen einen Möglichkeitsraum für den anderen, den menschlichen Blick aufs Sterben. Der umfassende palliativmedizinische Ansatz bezieht die Angehörigen mit ein und bietet ihnen Unterstützung an. Im Mittelpunkt steht der Einsatz für die Lebensqualität des Todkranken. Zuwendung und Kommunikation, das Versprechen ihm pflegerisch und ärztlich beizustehen, schaffen Geborgenheit und Sicherheit. Die Botschaft lautet: Du bist nicht allein! Die oben angesprochene Tatsache, dass das Sterben Teil des Lebens ist, wir hier eminent ernst genommen. Auch die Aufgabe der Ärztin, des Arztes wird weiter gefasst, er ist nicht nur dazu das, Leben zu retten, er hat auch für die Kultur des Sterbens Verantwortung zu übernehmen. Der Patient soll in seiner Ganzheit wahrgenommen, betreut und behandelt werden.
Trösten – Hinterlassen – Trauern
Maschinen und Apparate sprechen nicht und können nicht trösten. Zur Kultur oder sagen wir zur Kunst des Sterbens, die dem “Nichts” oder dem “Alles” des Todes eine Form gibt, gehört aber dass die menschliche “Trostbedürftigkeit” (Hans Blumenberg) am Lebensende ernst genommen wird. Nur indem wir diese anerkennen, können Angst und Sprachlosigkeit überhaupt überwunden werden. Gerade am Lebensende kann es im Gespräch zu sehr intensiven Momenten und Begegnungen kommen, die oft genug von Sterbenden und Nahestehenden gegen die entfremdenden und “verdinglichenden” Auswirkungen der Apparatemedizin erkämpft werden müssen. Trost kann dann schon allein dadurch entstehen, dass man dem Gegenüber zuhört, ihn seine Geschichte erzählen lässt und ihm so das Gefühl gibt, dass da etwas ist, das sich lohnt, hinterlassen und weitergegeben zu werden. Nicht selten passiert es ja, dass Menschen am Lebensende unerwartet verschütt geglaubte Geschichten, Lieder und Erinnerungen an die verlorene Heimat aus ihrem Gedächtnis hervorholen oder den Koffer mit ihren wichtigsten Dingen für die “letzte Reise” packen. Plötzlich reden sie dann von Dingen, über die sie vorher nicht reden wollten oder konnten. Es scheint dann, als würde in dieser spontanen Ars moriendi ein letztes Mal das Selbst und die eigene Geschichte erkundet. Die Persönlichkeit zeigt sich so stärker als früher, eine ganz andere, intensivere Nähe mit dem Gegenüber wird möglich. Diese Momente sind kostbar und die Überwindung dazu lohnt sich. Dass es das Bedürfnis danach gibt, persönlichen Geschichten aufzubewahren und weiterzutragen, zeigen Bücher wie “Oma, erzähl mal” oder “Erzähl mir dein Leben”. Diese Fragebücher formulieren Fragen zu den Biografien von Eltern und Großeltern, die Antworten können dann gemeinsam aufgeschrieben werden. Eine aktiv gestaltete Kultur des Hinterlassens kann für alle den Abschied am Lebensende erleichtern, und das Fragen und der Dialog stellen deren Bedingungen der Möglichkeit dar.
Zur Kultur des Sterbens gehört eine Kultur der Trauer, die das Sterben und was dann folgt nicht möglichst schnell “über die Bühne” bringt. Das kann die alte Totenwache sein. Hospize und Palliativstationen ermöglichen sie wieder. Vielleicht müssen wir den Sarg nicht wieder durchs Dorf tragen. Aber nicht umsonst gründen sich vermehrt gemeinnützige Vereine, die eine echte Alternative zu den kommerziellen Beerdigungsinstituten sind. Das wirklich professionelle Angebot echter Trauerbegleitung ist eine Lücke, vor allem da, wo Kirchen nicht gefragt oder gewollt sind. Diejenigen, die das Trauern abkürzen anstatt es “entschleunigend ” zu gestalten, verkennen, dass Trauerrituale und -inszenierungen den Abschied leichter machen und die Chance zu einer neuen Beziehung zu Tod und Sterben bieten. Oft genug braucht es aber natürlich Hilfe, Unterstützung, auch Wiedereinübung dessen, was Trauern bedeutet.
Sterbende Kaffeebohnen
Trösten, Hinterlassen und Trauern sind wichtige Bestandteile einer Kultur des Sterbens und der Gestaltung der Letztzeit – auch wenn sie die letzte Angst vor dem Tod, vor Schmerzen, Einsamkeit und Traurigkeit nie ganz nehmen können. Gesellschaftliche Solidarität mit den Sterbenden und ihren Nahestehenden bedeutet dann, Raum und Zeit für die Kultur des Sterbens zu schaffen. Ein anderer, offenerer Umgang mit Sterben und Tod bedeutet aber auch, dass im Gesundheitssystem und in der Pflege die richtigen Weichen gestellt werden. Eine solidarische und menschliche Gesellschaft muss sich der Herausforderung stellen, nicht zuletzt angesichts der “alternden Gesellschaft” und immer loseren sozialen Netzwerken. Der erste Schritt dazu ist es, das Sterben wahrzunehmen anstatt es ängstlich zu verheimlichen und zu verdrängen. Oder vorauseilend einer anonymen Technologie des Sterbens zu überlassen. Die Bereitschaft im Sterben die Dinge des Lebens noch einmal ganz anders betrachten zu können, ist vielleicht auch das, was diese Lebensphase reich machen kann. Ein außerordentlich witziges Sujet hat Rob Reiner im eingangs zitierten Film “Das Beste kommt zum Schluss” eben dafür gefunden. Edward nämlich liebte eine bestimmte Sorte Kaffee, es war die großartigste, wohlschmeckendste, vor allem wohl teuerste der ganzen Welt. Und nirgendwo auf der Welt, auch nicht im Krankenhaus, wollte er sein, ohne diesen Kaffee. Carter lehnt die Lifestyle-Luxusbohne rundheraus ab. Er weiß, dass die Kaffeebohnen “Kopi Luwak” solche sind, die von der Schleichkatze gefressen und dann wieder ausgeschieden werden. Als er Carter davon erzählt, kann der sich vor “geschissenem Katzenkaffe” nur ekeln. Hatte er denn wirklich alles falsch gemacht? Nein, aber das mit dem Kaffee offensichtlich schon. Was für ein Leben. Was für ein Sterben!