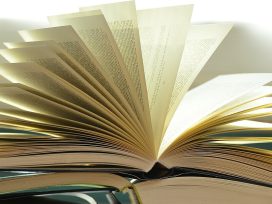Der arabische Pianist
Nach zwölf Jahren, in denen er Talente entdeckt und wichtige Studien geschrieben hatte, war mein Freund, der Peruaner, zum besten Kritiker der musikalischen Avantgarde von Paris geworden. Er hatte mir für meine letzte Nacht in der Stadt eine Überraschung versprochen, auf die ich ungemein gespannt war. Ich wartete am Carrefour de L’Odeon auf ihn, stieg in seinen Peugeot, wir schossen in Richtung Seine los, ließen uns abtreiben und parkten in der Nähe von Notre Dame. Ich dachte, wir würden dort ein klassisches Konzert in zeitgenössischer Fassung hören, so wie in jener magischen Nacht, in der Paquito D’Rivera die Welt mit seiner Jazzversion von Cosi fan tutte für Saxofon erbeben hatte lassen. Aber nein. Der Peruaner ging mit mir in eine Seitenstraße und weiter bis zu einer Treppe, die in eine Grotte führte. Erst vor zwei Wochen, sagte er, während wir hinabstiegen, habe er durch Zufall entdeckt, dass dort ein unbekanntes Genie namens Hassan Ibn Hassan spielte, ein postmoderner Pianist, der alle Geheimnisse der arabischen Musik, des Jazz, des Bossa Nova, Hip Hop und Reggae beherrschte. Wir betraten die halbleere Grotte, setzten uns in die Nähe des Pianos, bestellten Wein, und der Peruaner ließ mich wissen, dass er den arabischen Pianisten groß herausbringen wollte; wahrscheinlich, spekulierte er, war er in Beirut, Casablanca oder Rabat ausgebildet worden, denn in Paris konnte jemand wie er nicht unentdeckt bleiben. Kurz darauf betrat Hassan Ibn Hassan die Bühne, der Peruaner begann heftig zu applaudieren. Keiner der zehn oder zwölf Zuhörer in der Grotte tat es ihm gleich. Auch ich nicht, denn ich war von dem heftigen Gefühl in Anspruch genommen, Hassan Ibn Hassan schon einmal gesehen zu haben, der trotz des Applauses des Peruaners kein einziges Mal zu unserem Tisch herüberblickte. Er setzte sich mit einer Geste, die halb hochmütig, halb ressentimentbeladen war, ans Klavier und begann das Konzert mit Stücken aus seiner fernen Heimat. Die obsessive Wiederholung dieser traurigen Melodien stimmte mich depressiv. Hassan Ibn Hassan hatte schon einige Zeit Schmerz verbreitet, als er A night in Tunisia anging, und zwar übergangslos, mitten aus dem arabischen Rhythmus heraus, als ob die Welt der Musik nur eine wäre und er der König. Da kam in mir erneut das Gefühl auf, ihn schon einmal gesehen zu haben, ich schloss für ein paar Sekunden die Augen, sah ihn wieder an, aber die Einbildung verlor an Stärke und verschwamm langsam. Nein, ich hatte den arabischen Pianisten nie zuvor gesehen, doch erinnerte mich sein Aussehen stark an einen alten Bekannten, einen jungen kubanischen Pianisten namens Patrocinio Mendoza.
Ich hatte Patrocinio nicht mehr gesehen, seit ich vor zehn Jahren Kuba verlassen hatte, und obwohl seine Ähnlichkeit mit Hassan Ibn Hassan tatsächlich außerordentlich war, so waren es auch die Unterschiede zwischen beiden. Es schien seltsam, dass sich die zwei ähnlich sahen, da Patrocinio Mulatte und Hassan Araber war, doch hatten beide eine Haut wie Packpapier, lockiges Haar, kleine, abstehende Ohren und schwarze, tiefgründige, glänzende Augen. Aber Patrocinio Mendoza war jünger, größer, kräftiger und spielte außerdem vollkommen anders als Hassan. Es lag etwas Katzenartiges in der Beziehung zwischen Patrocinio und seinem Klavier, der Eleganz eines Panthers vergleichbar. Ich wurde wehmütig, als ich daran dachte, dass ich stets geglaubt hatte, Patrocinio Mendoza würde an die Spitze gelangen, der Erbe von Peruchín und Chucho Valdés werden, und ich sagte mir, dass mir wohl deshalb nichts mehr von ihm zu Ohren gekommen war, da er, wie so viele Musiker, sein Riesentalent in Alkohol ersäuft hatte. Ich verwechselte ihn wahrscheinlich mit Hassan Ibn Hassan, da ich so großes Verlangen hatte, ihn endlich wieder einmal zu hören, und schaute erneut den arabischen Pianisten an, der nun Caravan auf eine gebrochene, postmoderne, ungemein traurige Art spielte, die sein Stil war. Der Peruaner hatte Recht, er war ein Genie, und er ähnelte Patrocinio Mendoza wie ein schmutziger Wassertropfen einem sauberen. Sie waren praktisch identisch, doch was bei Patrocinio Vitalität gewesen war, war bei Hassan Skepsis; was bei dem Kubaner Freude war, war bei dem Araber verzweifeltes Leid; was beim ersten Harmonie war, war beim anderen Bruch. Patrocinio Mendoza war eine Naturkraft gewesen, Hassan dagegen ein besiegter Mensch, gebrochen wie sein Stil; er war es sogar physisch, denn sein Oberkörper verriet das fundamentale Ungleichgewicht der ungestalten Menschen. Doch konnte Caravan auch ein melancholisches und schmerzerfülltes Stück sein, wie geschaffen für das Leid, das die Gestalt des arabischen Pianisten verströmte, dessen gebrochene Version ohne jeden Zweifel die beste war, die ich je gehört hatte.
Ich stieß mit dem Peruaner an, streckte den Daumen in die Höhe, um ihm für dieses Geschenk zu danken, als Hassan El Manisero zu spielen anfing und ich mich auf ihn konzentrierte, um zu sehen, wie viel Trauer er diesem Lied, das ich auswendig kannte, verleihen würde. Er tat es von Anfang an, indem er den Rhythmus brach und verlangsamte und sanft “Maníííííí” sang. Heimweh überkam mich und ließ mich nicht mehr los, bis ich mir bewusst wurde, dass der arabische Pianist dieses Wort ganz deutlich ausgesprochen hatte. In meinem Kopf schlug es Alarm. Ich erinnerte mich daran, dass Aberdutzende Ausländer El Manisero aufgenommen hatten, aber ohne das Lied zu singen. Und die wenigen, die es wagten, taten es auf zumindest eigenartige Weise; Louis Armstrong zum Beispiel, von dem es eine ausgezeichnete Version gibt, sagt “Marie” statt “Maní”, wodurch er die Erdnuss des Originals zu einer Frau macht, um dann das “Caserita no te acuestes a dormir / sin comerte un cucurucho de maní” (“Hausfrau, geh doch nicht zu Bett / ohne vorher eine Tüte Erdnüsse zu essen”) durch einen Scat, einen Sprechgesang oder eine rhythmische Anhäufung gutturaler Laute zu ersetzen. Der arabische Pianist behalf sich mit keinem Scat, sondern sang mehrmals ganz deutlich “Maní”, begann dann einen wahnwitzigen montuno und legte plötzlich seine postmoderne Traurigkeit ab, als er es wagte, La chambelona und El alacrán mit demselben Enthusiasmus der Rumbaspieler zu zitieren, mit dem es Patrocinio Mendoza getan hätte.
“Der Typ ist Kubaner”, sagte ich. Als einzige Antwort legte der Peruaner den Zeigefinger auf die Lippen. Hassan erlaubte sich den Luxus, Palabras zu zitieren, einen wie eine Trennung gebrochenen Bolero, der nicht zum internationalen Repertoire gehört, kehrte zu El Manisero zurück, beendete ihn in einem kaputten, ausgebluteten Stil und verließ grußlos die Bühne. Ich stand auf, um ihm zu folgen. Der Peruaner hielt mich zurück, wer könnte denn auf die Idee kommen, der arabische Pianist wäre Kubaner? “Ich”, sagte ich, “was wettest du?” Das Abendessen, antwortete er und folgte mir in die Garderobe, ein elendes Loch, in dem der Pianist mit dem Rücken zu uns stand und sich den Mantel anzog. “Patrocinio!”, rief ich. Ein Ruck ging durch seinen Körper, als hätte er einen elektrischen Schlag erhalten, doch zog er sich langsam den Mantel an, drehte sich um und fragte in perfektem Französisch, wer ich sei, warum ich ihn störe, was ich wolle. Der Peruaner bat ihn in meinem Namen um Entschuldigung, es täte uns sehr Leid, sagte er, es wäre eine Verwechslung gewesen. Ich stimmte schweigend zu. Da ich den arabischen Pianisten von vorne sah, war es offensichtlich, dass ich mich geirrt hatte. Gewiss sah er Patrocinio Mendoza sehr ähnlich, doch hätte er sein älterer Bruder oder sogar sein Vater sein können. Der Peruaner gratulierte ihm zu seinem Konzert, bat ihn noch einmal um Verzeihung und kehrte in die Grotte zurück. Ich streckte Hassan meine Hand als Wiedergutmachung entgegen, er kam hinkend auf mich zu und umarmte mich plötzlich. “Warte draußen auf mich, asere1“, sagte er, “hier schadest du mir.”
Ich gehorchte, ungläubig, enthusiastisch und gespannt, kehrte in die Grotte zurück und packte den Peruaner am Arm. “Ich habe gewonnen”, sagte ich. “Gehen wir.” Er verstand nicht und weigerte sich heftig, meinen Sieg zu akzeptieren. Doch war es mir vollkommen egal, wer das Abendessen bezahlen würde, ich wollte nur das Gespenst Patrocinio Mendozas treffen. Wir mussten nicht lange warten. Ein paar Minuten, nachdem wir gegangen waren, kam Patrocinio mit schmerzverzerrtem Gesicht die Treppen der Grotte heraufgestiegen. Als ich auf ihn zutrat, um ihm den Peruaner vorzustellen, bat er mich mit leiser, verschwörerischer Stimme, ihn Hassan zu nennen und Französisch zu reden. Ich gehorchte, doch kaum waren wir hundert Meter vom Lokal entfernt, als Patrocinio selbst anfing, in tiefstem Kubanisch zu sprechen, was ihn oft dazu zwang, ein Wort oder einen Ausdruck für den Peruaner zu übersetzen. Er ging langsam, wie ein alter Mann, auch wenn der schmerzvolle Ausdruck auf seinem Gesicht verschwunden war, und er blieb immer wieder stehen, um mich anzusehen oder zu berühren. Es schien ihm ebenso schwer zu fallen, meine Anwesenheit zu begreifen, wie mir die seine. Er freue sich, mich zu sehen, meinte er, aber es war auch ein Riesenspatz für ihn, das heißt, sehr traurig, übersetzte er für den Peruaner, denn er war tot und hatte sich von allem verabschieden müssen.
Er ging ziellos dahin – zumindest glaubte ich dies in dem Moment -, wechselte häufig den Gehsteig, bog um jede Ecke und schaute nach hinten und um sich, als fürchtete er, verfolgt zu werden, obwohl die Gassen ganz offensichtlich leer waren. Doch kaum waren wir etwas weiter von der Grotte entfernt und in eine Avenue eingebogen, die parallel zur rive gauche führte, beruhigte er sich und begann auf uns einzusprechen, als müsste er die Geschichte, die ihn innerlich aufwühlte, ein für alle Mal loswerden. Sein Tod, erzählte er, war genau vor acht Jahren, drei Monaten, zwölf Tagen und fünfzehn Stunden passiert, an einem Ort wie dem hier, seht ihr, sagte er und deutete auf eine menschenleere Bushaltestelle. Er war vom Kaiman gekommen, also von Kuba, übersetzte er, um eine Woche in einer heruntergekommenen boite zu spielen, sich ein paar Francs zu verdienen und zu sehen, ob er in Paris eine Platte aufnehmen könnte. Aber aus der Platte wurde nichts, sagte er, rien de rien, er spielte eine Woche und stand eines Morgens an einer Haltestelle wie der hier, total fertig und verschlafen, als plötzlich ein Mercedes wie ein Wirbelsturm einbog, die Haltestelle umriss und ihn gleich mit. Es war eine Scheißsache!, rief er aus, beruhigte sich aber wieder, indem er auf die Lichter blickte, die sich wie Diamanten in der Seine spiegelten, und setzte seine Geschichte fort. Ja, wenn dir ein Riesenauto drüberfährt und du dich tot fühlst, dann ist das eine Scheißsache, murmelte er leise und skeptisch, als wäre er davon überzeugt, dass wir nie fähig sein würden, ihn zu verstehen, denn man konnte nicht sprechen und fühlte nichts, fuhr er fort, außer die panische Angst, für immer im Arsch zu sein, nie wieder spielen zu können, in einem Augenblick zu einem Bewohner des anderen Viertels geworden zu sein.
Er machte eine Pause und imitierte sehr leise das Geräusch einer Sirene, die immer lauter und schließlich unerträglich wurde, bis sie hier vor uns stehen blieb. Es war geil, sagte er, denn die Rettung verbreitete ein orangefarbenes Licht, wie aus der anderen Welt, das kam und ging, kam und ging, kam und ging, während der Rettungsfahrer über Funk meldete, dass es einen total zertrümmerten Mercedes gab und einen toten Araber. Und der tote Araber war er, verdammt noch einmal, er höchstpersönlich! Patrocinio Mendoza, der Sohn von Mercedita!, rief er aus, als befürchtete er, wir würden es ihm nicht glauben. Dann, fuhr er fort, war nichts, nothing, rien de rien, zwei Wochen lang. Bis er eines Tages die Augen aufschlug und sich von Kopf bis Fuß in Bandagen eingegipst wiederfand, wie eine ägyptische Mumie. Neben ihm stand ein Typ, ein fescher Kerl mit rotem Haar wie der Teufel, weißem Kragen und Krawatte, der auf Französisch heftig auf ihn einsprach. Er verstand nicht das Geringste, und der múcaro, also der Weiße, übersetzte er, begann Spanisch zu reden, stellte sich als Anwalt vor und erklärte ihm, dass sie klagen und dem man des Mercedes jede Menge Francs abnehmen könnten, als er den Unfall hatte, war er besoffen, und er hatte mehr Geld als die Banque de France. Der Anwalt hatte keine Ahnung, wer er war, erst glaubte er, er wäre ein sans papier, ein Unglücksrabe, doch als er erfuhr, dass er Pianist war und ein Visum hatte, wurde er glücklicher als eine Rumba del Solar. Naja, und sie gewannen den Prozess, der man mit dem Mercedes musste ihm drei Jahre Krankenhaus bezahlen und sieben Operationen, durch die er, schau, und er zeigte seine orthopädischen Schuhe und eine Prothese am linken Knie, ein Stück Scheiße geworden war, meinte er, geflickt und noch einmal geflickt, wie die einzige Hose seines Großvaters.
Da leuchteten plötzlich die Positionslichter eines BMW-Coupé auf, das zehn Meter vor uns geparkt war. Ich sprang zur Seite. Nur ruhig, Chucho, sagte Patrocinio ironisch und zeigte mir die Fernbedienung, das Schiff gehöre ihm, der Tod habe ihn reich gemacht, der man mit dem Mercedes musste ihm außerdem einen Haufen Francs bezahlen, so dass er seit damals überhaupt keine Probleme mehr habe, außer dem, dass er tot wäre, klar. “Aber warum”, wagte ich ihn zu fragen. Im Licht der Laterne zeigte er mir seine Hände, seine großen, privilegierten Pianistenhände. “Was haben sie denn”, fragte der Peruaner? Nichts, antwortete Patrocinio, sie hatten überhaupt nichts, denn dem Chirurgen zufolge hatte er sie bei dem Unfall unbewusst geschützt, mehr als irgendeinen anderen Körperteil, wie es eine Mutter mit ihrem Kind getan hätte, genau so, sagte er und wiegte seine eigenen Riesenhände im Scherz. Doch hätte dies dem rothaarigen Anwalt überhaupt nicht gefallen, fügte er hinzu, so dass er und der Arzt vereinbarten, auch Hand an die Sache zu legen. Sie behaupteten, dass sie als Pianistenhände eine Menge wert wären. Das Ergebnis? Er schnitt sich mit dem Zeigefinger den Hals durch, bevor er antwortete, eine riesige Entschädigung, deren fünfte Klausel lautete, dass der Pianist Patrocinio Mendoza infolge des Unfalls auf absolute und irreversible Weise nicht mehr im Stande wäre, seinen Beruf auszuüben. Seit damals ziehe er umher, murmelte er, mit drei Reisepässen und drei falschen Namen, spiele umsonst in Spelunken in Paris, London oder Amsterdam, würde das Licht wie die Vampire scheuen, weshalb er uns um etwas ersuchen wolle, sagte er, wir sollten bitte niemandem weitersagen, dass wir ihn spielen gehört hatten, stieg in den BMW, schoss wie ein Bolide davon und war im Nu im Schatten verschwunden.
asere - typisch kubanische Interjektion
Published 3 August 2001
Original in Spanish
Translated by
Georg Pichler
Contributed by Wespennest © Wespennest Eurozine
PDF/PRINTNewsletter
Subscribe to know what’s worth thinking about.