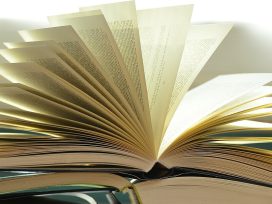Von den Privilegien der Literaturkritik
Der Herbst ist die Zeit der Ernte und der Erntedankfeste. Das ist im Literaturbetrieb nicht anders als in der Landwirtschaft. In den Wochen vor der großen Ernte der Buchmesse, wenn die neuen Bücher schon gedruckt, aber noch nicht ausgeliefert sind, und die Kritiken erst noch geschrieben werden müssen, beginnt die Saison der feierlichen Abendessen. Die Verlage laden dann gerne in exquisite Restaurants, um dort Autor XY mit seinem lang erwarteten Roman vorzustellen. Zehn bis fünfzehn Redakteure und Kritiker versammeln sich zum Aperitif und beäugen den Schriftsteller, der eher stumm an der Seite des Verlegers verharrt. Der Verleger spricht einige Sätze über dieses wunderbare Buch, das in diesem Herbst für Furore sorgen wird, “da bin ich mir ganz sicher”, sagt er, denn er sei tief beeindruckt, und die sympathische Leiterin der Presseabteilung nickt bekräftigend. Dem Autor ist das eher peinlich, weil er sich der Präsentationshaftigkeit des Augenblicks und seiner selbst schmerzlich bewusst wird. Er zupft sich am Ohr, greift sich an die Nase und ist froh, wenn alle sich endlich setzen. Es gibt soufflierten Steinbutt mit Seehasenrogen und Tomatenmarmelade, gefolgt von einer Kokossuppe mit Entenbrust unter Maniokstroh. Als Hauptgericht wird gebratener Lammrücken im Crêpemantel mit Flusskrebsen und getrüffeltem Selleriepüree gereicht, zum Abschluss Pistazienmousse mit Himbeereis und süßen Schupfnudeln. Das klingt, als handle es sich um Poesie, als müsste die Genussfähigkeit der Kritiker angeregt werden, ehe sie mit der Lektüre beginnen. Wenn ich wollte, könnte ich in den Wochen vor der Messe fast jeden Abend so oder so ähnlich verbringen und mich dabei in einen Gourmet verwandeln.
Die Frage, die sich dann aber aufdrängt, lautet: Welchen Einfluss haben solche Veranstaltungen auf die Buchkritik? Stimmt gutes Essen das Urteil milder? Sorgt die freundliche Atmosphäre eines mit dem Autor verbrachten Abends dafür, auch gegenüber dem zu besprechenden Werk freundlich zu sein? Die Verlage würden wohl kaum diesen Aufwand betreiben, wenn sie nicht annehmen dürften, dass die Mühe sich lohnt. Sie hoffen, damit zumindest ein schlechtes Gewissen bei denen zu produzieren, die zwar gut gegessen haben, das Buch aber trotzdem nicht rezensieren. Mit solchen Widersprüchen hat es der Literaturkritiker dauernd zu tun. Er führt eine doppelte Existenz. Er bewegt sich in zwei Sphären, die nichts miteinander zu tun haben: dem Literaturbetrieb und dem Lesen. Auf der einen Seite ist er ein Gesellschaftswesen und braucht besondere kommunikative Fähigkeiten. Auf der anderen Seite ist er ein knurriger, vereinzelter Mensch, der bei seiner Lektüre ungestört bleiben will. Das doppelte Anforderungsprofil hält ihn beweglich. Die Einsamkeit des Schreibtisches bei Bedarf mit dem gesellschaftlichen Parkett tauschen zu können, sorgt dafür, dass er auf keiner der beiden Seiten zu leiden hat.
Nach diesem eher heiteren Prolog könnte ich nun in das obligate kulturkritische Lamento einschwenken. Ich könnte die Dominanz des Marktes beklagen oder besorgt sein, dass nicht mehr genügend gelesen werde. Dass die Buchkultur durchs Internet bedroht sei. Dass die Literatur und mit ihr die Literaturkritik in einem unaufhaltsamen Erosionsprozess an Bedeutung verliere, ja, dass es bald gar keine Literaturkritik mehr gebe, sondern nur noch Warentest und Product-Placement. Und dass Kritiker sich dann in Agenten verwandelt haben werden, die nicht mehr von Zeitungsredaktionen, sondern direkt von den Verlagen bezahlt werden. Schließlich werden sie ja auch von den Verlagen und nicht so sehr von ihren Redaktionen für wichtig befunden. Das alles lasse ich weg. Das Lamento liegt mir nicht. Ich möchte auch nicht in die Klagen der Freiberufler einstimmen, die über immer kürzere Sendezeiten und Artikellängen jammern, über gekürzte Honorare, geprellte Internetrechte und das mühsame Eintreiben der Mehrwertsteuer, über ihren KSK-Beitrag und die Zukunft der VG Wort. Dieser Klagegesang, so berechtigt er auch sein mag, hat nicht viel mit meiner Berufserfahrung zu tun. Mein Gefühl teilt mir etwas ganz anderes mit. Es sagt mir: “Der Literaturkritiker ist ein privilegierter Mensch, und Du kannst froh sein, so einen großartigen Beruf auszuüben.” Ich möchte endlich einmal die Privilegien hervorheben, die das Dasein dem freien Literaturkritiker zubilligt. An die Stelle des Lamentos setze ich den Hymnus – auch wenn ich mir bewusst bin, dass man als Lobredner leicht in den Verdacht der Naivität geraten kann. Weit verbreitet ist die Ansicht, der Lobende habe nur versäumt, genauer hinzusehen. Wer kritische Einwände formuliert, gilt dagegen grundsätzlich als scharfsinnig. Die Negation hat einen besseren Ruf als die Affirmation, und das ist einer der Gründe, warum die Christiansenisierung der Republik voranschreitet. Sie bringt fortwährend unheilschwere Schlagzeilen nach dem Muster “Deutschland am Abgrund – sind wir noch zu retten?” hervor. Aber ist das schon Kritik?
Es gehört zu den Paradoxien des Geschäfts, dass der Beruf des Kritikers von dieser Bevorzugung der Negation nicht profitiert. Kritiker sind gesellschaftlich betrachtet nicht besonders angesehen – sieht man einmal von ihren seltenen papsthaften Erscheinungsformen ab. Auf Karikaturen handelt es sich um Leute mit extra eckigen Brillen, die eifernd ihre Zeigefinger schwenken. Wer seine Profession darin sieht, andere zu kritisieren, darf nicht darauf zählen, für sympathisch zu gelten. Kritiker sind Sekundärschweine, die an fremder Kreativität herumschmarotzen. Ihr gesellschaftlicher Nutzen – oder gar ihre Notwendigkeit – ist nicht so leicht zu begründen wie der des Bäckers, des Arztes oder auch des Schauspielers. Was soll denn das für ein Beruf sein, der darin besteht Bücher zu lesen und dazu eine Meinung zu entwickeln? Lesen, so ein weit verbreitetes Vorurteil, ist nichts anderes als eine Strategie, Arbeit zu vermeiden. Dass die übermäßige Lektüre von Romanen den Charakter verderbe, spukt als Volksweisheit des 19. Jahrhunderts durch die Köpfe. Ich muss gestehen, dass ich mich angesichts dieser Ausgangslage erst einmal damit abfinden musste, zu einem Literaturkritiker geworden zu sein. Dass es sich dabei um ein privilegiertes Dasein handelt, habe ich nicht sofort begriffen, ja, ich habe mich dieser Tätigkeit eher geschämt, als stolz darauf zu sein. Man wird ja nicht als Literaturkritiker geboren, und in die Liste jugendlicher Traumlebensentwürfe gehört das Kritikerwesen auch nicht gerade. Es handelt sich nicht um einen Beruf, den man wählen oder zu dem man sich anmelden kann und dann einfach damit beginnt. Bei mir war es ein schleichender Prozess, eine fortdauernde, allmähliche Spezialisierung, die mich von lokaljournalistischen Anfängen über die Arbeit als Kulturredakteur einer Wochenzeitung zum Literaturredakteur einer Tageszeitung, dann zum fest gebundenen Pauschalisten und schließlich zum freiberuflichen Autor gemacht hat. Das Wort “Literaturkritiker” bezeichnet all diese Tätigkeitsbereiche nur ungenau, denn es deckt immer nur einen Teil der beruflichen Existenz ab, und es verschweigt die damit einhergehenden wechselnden Abhängigkeiten. Als Redakteur, der Aufträge verteilt und Kritiken redigiert, der gewichtet und bestimmt, was auf seinen Seiten wichtig wird, war ich abhängig von den Ideen oder auch nur den Launen von Chefredakteuren und Herausgebern, vom Anzeigenaufkommen und von dem großen Geflecht an Interessen, das Tag für Tag auf den Konferenzen entwirrt werden muss. Als Pauschalist war ich abhängig von der ökonomischen Gesamtlage und der Gunst der Stunde. Als Freiberufler bin ich nun abhängig von der Auftragslage und das heißt von der Gunst der Redakteure. Ich kann diese Abhängigkeit nur dadurch mildern, dass ich mich von möglichst vielen abhängig mache. Das führt dazu, dass ich nun in einer Redaktion als Experte für Osteuropa gelte, in einer anderen als Spezialist für englische und amerikanische Literatur, in einer dritten glaubt man, ich kenne mich besonders gut mit junger deutschsprachiger Literatur aus. Ich lasse alle in ihrem Glauben. Und damit bin ich endlich bei den Privilegien, von denen ich doch sprechen wollte.
1. Privileg: Literaturkritik fühlt sich nicht wie Lohnarbeit an
Zunächst einmal: Was für ein Glück! Ich muss nicht um fünf Uhr aufstehen oder um sechs Uhr in der Fabrik antreten. Ich muss nicht fünfzig Kilometer zum Arbeitsplatz fahren und abends dann schon wieder im Stau stehen. Ich muss mich nicht mit hysterischen Chefs und nervtötenden Kollegen herumärgern, und ich muss keine Produkte herstellen, die mich gar nicht interessieren. Stattdessen begebe ich mich, wenn ich in Form bin, an den Schreibtisch, um zu tun, was ich sowieso am liebsten tue: Lesen und Schreiben. Es erscheint mir immer noch wie ein Wunder, dass ich dafür am Ende auch noch Geld bekomme und davon leben kann. Unter allen Möglichkeiten, Geld zu verdienen, kommt mir diejenige, das lesend und schreibend zu tun, am luxuriösesten vor. Das ist eine Arbeit, die mir auf so unverschämte Weise entspricht, dass ich sie gar nicht als Arbeit empfinde. Es fällt mir deshalb schwer, sie als Berufstätigkeit zu begreifen. Lesen und Schreiben bezeichnen vielmehr eine besondere Art, in der Welt zu sein. Es handelt sich um eine saubere, elegante Existenzweise. Lohnarbeit – das hat mir meine protestantische Erziehung von klein auf eingeflüstert – wäre etwas, das unfreiwillig geleistet wird, etwas Quälendes. Wenn man nicht schwitzt und leidet bei der Arbeit und ölverschmierte Hände bekommt, dann stimmt etwas nicht. Bei Marx habe ich später gelernt, dass der Lohnarbeiter Zeit verkauft, seine Lebenszeit, die der Kapitalist in Mehrwert ummünzt. In jedem Produkt steckt diese geronnene Arbeit. In jedem Lohn die entäußerte Zeit.
Das trifft natürlich auch auf die Literaturkritik zu. Auch der Text ist ein Produkt, das aus den Bestandteilen Sprache und Zeit besteht. Und ich will nicht verhehlen, dass es Momente gibt, in denen das Schreiben zu gefühlter Lohnarbeit ausarten kann. Es gibt quälende Bücher, die aber trotzdem zu Ende gelesen werden müssen. Es gibt Tage, an denen das Schreiben schwer fällt, aus Termingründen aber erledigt werden muss. Würde ich die Zeit, die ich dafür brauche, einen Roman zu lesen, als Arbeitszeit berechnen, dann wären Literaturkritiken beleidigend schlecht bezahlt. Allenfalls schmale Lyrikbände könnten profitabel sein, aber die werden nur selten besprochen. Rechnen wir zehn Stunden für 400 Seiten – was flott gelesen wäre. Dazu eine Besprechung von 150 Zeilen, die mit 150 Euro vergleichsweise gut honoriert würde. Veranschlagen wir dafür als reine Schreibzeit drei Stunden. Macht einen Stundenlohn von 11 Euro 50. Zeit um nachzudenken oder um ein zweites Mal zu lesen oder gar Hintergründe zu recherchieren, weiterzulesen, ist dabei nicht berücksichtigt. Wenn man so rechnet, müsste man sofort zum Literaturkritikerstreik aufrufen. Das wäre ein interessantes Experiment: Die Vertreter dieser Zunft bewaffnen sich mit Trillerpfeifen, streifen sich diese seltsamen Protestlätzchen aus Plastik über, die streikende Gewerkschafter gerne tragen, und versammeln sich vor dem Brandenburger Tor. Preisfrage: Wie groß wäre wohl die gesellschaftliche Unterstützung für die Forderung nach besser bezahlter Literaturkritik?
Die Vorstellung ist deshalb so lächerlich, weil Lesen eben keine Lohnarbeit ist. Man kann Bücher nicht nach Stückzahlen abarbeiten. Rationalisierungsmaßnahmen sind beim Lesen nicht möglich. Und die Zeit spielt schon deshalb keine Rolle, weil man sie beim Lesen vergisst. Lesen, wenn es gelingt, bedeutet, in eine andere Zeitrechnung einzutauchen, die nicht quantifizierbar ist. Das Lesen ist nicht – wie andere Arbeit – eine Entäußerung, sondern eine Bereicherung. Man erhält etwas, das sich in Geld gar nicht ausdrücken lässt. Wer mit Literatur zu tun hat, handelt mit einem kostbaren Rohstoff: mit fremden Erfahrungen. Als Leser akkumuliert man diese Lebensstoffe. Bevor der Literaturkritiker also damit beginnt, sein Produkt – die Kritik – herzustellen, hat er schon eine ganze Menge gewonnen. Und dann darf er auch noch darüber schreiben. Das Honorar, das irgendwann eintrifft, kann dieses Gefühl nicht angemessen ausdrücken. Lesen zu dürfen ist ja schon ein Gewinn. Dafür auch noch entlohnt zu werden, ist ein Privileg. Aber es kommt noch besser, und damit bin ich beim
2. Privileg: Jede Menge Bücher
Nicht nur, dass ich als Literaturkritiker das Glück habe, aus einer Passion eine Profession zu machen. Ich bekomme den Rohstoff meiner Leidenschaft auch noch frei Haus geliefert. Bücher ohne Ende, mehr als ich lesen kann. Viele kommen einfach so, mit einem freundlichen Begleitschreiben des Verlages, andere, weil ich sie bestellt habe. Wenn ich etwas lesen will, dann muss ich nicht in die Buchhandlung, sondern nur zum Briefkasten. Paradiesische Zustände. Allein dafür würden manche alles geben, Literaturkritiker zu sein. Allerdings werde ich auch oft gefragt, ob es nicht schrecklich sei, so viele Bücher zu lesen. Die Metapher von der Bücherflut legt ja den eigenen Untergang in diesem Ozean nahe. Um in der Flut-Metapher zu bleiben: Baden und herumplantschen machen Spaß. Schwimmen ist Sport und nicht jedermanns Sache. Aber auch der ausdauerndste Athlet säuft irgendwann ab, wenn er nicht rechtzeitig aus dem Wasser steigt. Die Sorge, zu viele Bücher könnten eine derart ertränkende Wirkung ausüben, ist dem Irrglauben geschuldet, andauerndes Lesen führe zu einem Verlust der Aufnahmefähigkeit. Der professionelle Leser verliere durch die Menge der Bücher die unverstellte Naivität des Zugangs. Ich behaupte: Das Gegenteil ist wahr. Je geübter ich bin, umso intensiver werden meine Lektüre-Erlebnisse. Je mehr ich lese, umso mehr bleibt übrig. In einer Aufhebung physikalischer Gesetzmäßigkeiten wächst mit der Menge des Gelesenen auch die Menge des Ungelesenen oder dessen, was ich noch lesen will. Mit jedem neuen Buch erweitert sich dieser Kosmos. Man kann nie genug lesen. Man hört ja auch nicht auf zu essen oder zu trinken.
Lesen ist eine Art, in der Welt zu sein. Es setzt die Bereitschaft voraus, sich auf andere Lebens- und Sichtweisen einzulassen, sich anderen Erfahrungen zu öffnen. Leser können deshalb keine Fundamentalisten sein. Das ist der Grund, weshalb Literatur in Diktaturen als Bedrohung wahrgenommen wird. Leser wollen die Totalität der Lesevielfalt, aber sie sind zwangsläufig antitotalitär. Das sollte auch für Kritiker als Berufsleser gelten. Sie verfehlen ihre Profession, wenn sie sich zu Verfechtern bestimmter literarischer Konzepte machen und sich in Eiferer, Rechthaber, Dogmatiker verwandeln. Literatur und Rechthaben passen nicht zusammen. Das ist der Ausgangspunkt aller Literaturkritik. Ein Toleranzgebot. Was mir missfällt, muss deshalb noch lange nicht unmöglich sein. Es gibt viele Berufe, die mit Lesen und Schreiben zu tun haben: Bürokräfte, Öffentlichkeitsarbeiter, Journalisten, Wissenschaftler. Es gibt keine Schriftsteller, die nicht auch Leser wären, und vermutlich gibt es keine wirklichen Leser, die nicht insgeheim auch schreiben würden. Wer sich im Medium der Sprache bewegt – und damit meine ich: in der Literatur – kann sich nicht auf eine der beiden Hälften beschränken. Doch nur in der Literaturkritik setzt sich das Lesen direkt im Schreiben fort. Nur der Literaturkritiker schreibt unmittelbar über das Gelesene. Zwei Bewegungen, die untrennbar zusammengehören, finden in der Literaturkritik zu einer Einheit. Und nur hier! Selbst in der Literaturwissenschaft ist es anders, weil die schriftliche Reaktion da weniger spontan erfolgt und durch zahlreiche Sekundärtexte vermittelt wird. Das wissenschaftliche Bemühen zielt tendenziell darauf, Lesen und Schreiben analytisch zu trennen. Die Literaturkritik betreibt die empirische Verschmelzung. Literaturkritik ist ein Erlebnisbericht, als journalistisches Genre vielleicht der Reisebeschreibung vergleichbar. Allerdings handelt es sich um Reisen im Reich der Fiktionen. Und damit bin ich beim
3. Privileg: Die Erweiterung der Welt
Reise und Lektüre sind Bereiche, denen in einer Zeitungsredaktion – vorsichtig gesagt – eher untergeordnete Bedeutung zugemessen wird, als Begleitprogramm in der Freizeitbeilage. Das Feuilleton ist ein Randphänomen, das nur zehn bis fünfzehn Prozent der Leserschaft wahrnehmen. Die Literatur ist davon wiederum nur eine Teilmenge. Entsprechend lässt sich das Ranking des Kritikers innerhalb des Journalismus errechnen. Auch darüber könnte man klagen. Ich möchte die mediale Aufmerksamkeitszurückhaltung für einen Vorteil halten. Es ist ein Privileg, dass das, worüber man schreibt und wie man das tut, kaum einmal Gegenstand der Redaktionskonferenz wird – es sei denn, es hat sich gerade herausgestellt, Günter Grass war bei der Waffen-SS. Manchmal kommen Kollegen vorbei und fragen, ob man ihnen etwas empfehlen könne unter den Neuerscheinungen. Auch empörte Leserbriefe erhält der Literaturkritiker ausgesprochen selten. Er befindet sich am Rand des Randes der Öffentlichkeit. Das ist ein guter Platz. Von hier aus lässt sich die Welt besser überblicken. Die Geringschätzung von Literaturkritik ist nicht einfach damit zu erklären, dass es sich bei Literatur um ein Minderheitenprogramm handelt. Vielmehr steckt darin ein grundlegendes Missverständnis, ein schwerwiegender kultureller Mangel: der Glaube nämlich, dass der Raum des Fiktiven, mit dem man es in der Literatur zu tun hat, irrelevant sei. Die Öffentlichkeit ist so durchdrungen von der Bedeutung des Faktischen, von Information, Nachrichten, Tagesaktualität, vom politischen Meinen und vermeintlichen Handeln, dass für das Fiktive – oder nehmen wir ein anderes Wort dafür: für das Mögliche – keine Aufmerksamkeitspotentziale mehr übrig sind. Deshalb ist die “Tagesschau” gefüllt mit langweiligen Beiträgen über parteipolitisches Gerangel: wer was über wen gesagt hat, und was das zu bedeuten haben könnte. Dass es sich dabei um eine Abbildung von Realität handelt, ist eher unwahrscheinlich. Aber es ist das, was wir uns als Wirklichkeit zu betrachten angewöhnt haben. Schließlich sind wir am Ende selbst dafür verantwortlich, was wir uns als Realität vorsetzen lassen.
Als Literaturkritiker hat man es mit einer anderen Art von Wirklichkeit zu tun: mit der Fiktion oder dem Möglichen, einer Wirklichkeit im Konjunktiv. Jeder Roman ist ein Entwurf: So könnte es sein. Das ist nicht weniger real als der übliche mediale Alltagsbrei. Vielmehr handelt es sich dabei um eine vierte Dimension, eine Tiefenschicht der Erfahrungen, die der äußeren Welt hinzugefügt wird. Dieser Raum der Möglichkeiten ist in jedem Augenblick der Geschichte unendlich viel größer als das Feld des Faktischen. Es macht die Medienöffentlichkeit ärmer, dass sie sich nicht viel intensiver mit dem Möglichkeitsraum befasst. Dass die Welt nicht so sein muss wie sie ist, sondern auch ganz anders sein könnte, erfährt man nicht in der “Tagesschau”, sondern in Romanen. Sie vermitteln, was es bedeutet, in einer bestimmten Epoche oder Weltgegend zu leben. Mein Weltatlas und mein Geschichtsbild entstehen und verändern sich auf diese Weise. Geschichte ist das, was gewesen ist; Poesie ist, was hätte sein können. Aber Geschichte ohne Poesie bleibt flach und leblos. Wenn ich Literatur als einen Möglichkeitsbereich der Realität bezeichne, dann meine ich gar nicht so sehr die utopischen Partikel, die darin stecken können, dass eben auch das Versäumte, Unentwickelte, Verworfene, Verpasste, Übersehene, Unterschätzte, Missachtete zur Sprache kommen kann. Dass Literatur das Erwünschte, Erhoffte, Herbeigesehnte als Wirklichkeit behaupten kann. Vielmehr enthält die Fiktion schon vor allen konkreten Erzählstoffen ein utopisches Potenzial. Das gilt auch für den lückenlos durchrecherchierten Dokumentarroman. Jede Erzählung entfaltet eine eigene Welt, ein eigenes Innenleben, eine eigene Perspektive. Sich lesend darauf einzulassen heißt immer auch zu staunen über die besondere Art und Weise, in der Welt zu sein, die darin zum Ausdruck kommt. Dieses Staunen muss die Kritik transportieren. Sie muss in einem elementaren Sinn begreiflich machen, was Literatur ist und was beim Lesen geschieht. Das greift natürlich weit über das einzelne Buch hinaus und überschreitet die schlichte Funktion der Kritik, gute Bücher als gut und schlechte als schlecht zu kennzeichnen. Die Tiefendimension der Erfahrung – des Autors einerseits und des Kritikers als reagierendem Leser andererseits – wäre mit dem Urteil “gut” oder “schlecht” nicht einmal ansatzweise zur Sprache gebracht. Erfahrungen sind überhaupt erst dann etwas wert, wenn sie aufeinander reagieren, wenn sie sich relativieren, in Frage stellen. Deshalb gibt es Kritik nicht im Singular, sondern nur im Gespräch, nicht als apodiktisches Urteil, sondern als Sichtweise, die durch andere Sichtweisen zu ergänzen ist. Im Konzert der kritischen Stimmen entsteht erst der Raum, den Literatur braucht, um sich zu entfalten.
Ich glaube, das ist die eigentliche und einzige gesellschaftliche Funktion der Literaturkritik. Sie ist kein Missionsdienst, in dem es darum gehen würde, möglichst viele Menschen zum Lesen zu bekehren – ein Glaube, der beispielsweise Elke Heidenreichs Sendung “Lesen!” (mit dem programmatischen Ausrufezeichen im Titel) beseelt. Literaturkritik ist das Selbstgespräch der literarischen Welt – nicht weniger, aber auch nicht mehr. Dieses Gespräch droht aber dann zu verstummen, wenn die Kritiken zu einem Buch alle gleichzeitig erscheinen. Der Aktualitätszwang, der aus der Konkurrenz der Medien entsteht, führt dazu, dass Spitzentitel oder Werke besonders prominenter Autoren sofort am Erscheinungstag abgehandelt werden müssen. Jeder einzelne Redakteur mag dieses Wettrennen bedauern oder auch seine sportive Freude daran entwickeln – ignorieren kann er es nicht. Das bedeutet aber, dass Kritiken nicht mehr aufeinander reagieren können, dass sich ein Urteil nicht mehr als gesellschaftlicher Prozess herausbildet und entwickelt. Stattdessen gibt es einen großen Knall – und dann ist alles vorbei. Wer es darauf anlegt, aufzufallen, der muss in dieser Gleichzeitigkeit der Stimmen auf schrille Effekte setzen, auf das Übertrumpfen der Konkurrenten mit besonders markigen Urteilen. Ablesen lässt sich diese Tendenz an der Zunahme der Superlative: all der wöchentlich ausgerufenen besten Bücher des Jahres, der wachsenden Vorliebe für die Attribute wunderbar, großartig, ergreifend et cetera. Das hat damit zu tun, dass Redakteure gegenüber ihren Chefredakteuren und Freiberufler gegenüber ihren Redakteuren eine Rechtfertigung benötigen für den Platz, den sie beanspruchen. Besprechungen von Büchern die “wunderbar” sind, lassen sich nun mal leichter durchsetzen als die gepflegte Mittellage. Nur das Besondere, das Außerordentliche hat ein Daseinsrecht. Deshalb gibt es so viel davon. Damit bin ich bei einem Thema, das zwar zu den Privilegien gehört, das aber mit Vorsicht zu genießen ist:
4. Privileg: Das Ausleben der Emotionen
Welcher andere Beruf bietet so uneingeschränkte Möglichkeiten, seinem Ärger Luft zu machen oder seine Glücksgefühle zu bekunden? Wo ist es erlaubt, ja geradezu gefordert, Missfallen derart wortreich auszuformulieren und seine Schwärmereien so ungebremst vorzutragen? Der Kritiker braucht seinem Temperament keine Zügel anzulegen. Das sollte seinem Gesundheitszustand dienlich sein.
Es gehört zu den Gemeinplätzen des Redens über Literaturkritik, dass es sich dabei um ein subjektives Genre handelt. Im Extremfall kann die Entfaltung der Subjektivität so weit führen, dass das Subjekt des Kritikers alles andere verdrängt, sogar das Argument. Wer erst einmal Literaturpapst genannt wird, darf auch auf die eigene Unfehlbarkeit rechnen. Dass ein Buch gut oder schlecht sei, ergibt sich dann notwendigerweise daraus, dass er es für gut oder schlecht befunden hat. Von Marcel Reich-Ranicki gibt es sogar eine Aufsatzsammlung mit dem Titel Lauter Verrisse – als ob der Verriss ein eigenes Genre wäre, in dem Kritik erst zur Kenntlichkeit kommt. “Loben” und “verreißen” prägen allerdings eine Polarität, die den komplexen Lektürevorgang nur ausnahmsweise zu fassen vermag. Wenn ein Buch eine besondere Wirkung auf mich hat, dann wäre das “Loben” eine allzu flache Reaktion darauf. Und Verrisse zu schreiben dient vielleicht dem eigenen Emotionshaushalt, ist ansonsten aber eher überflüssig. Zum Ärgernis, mit einem schlechten Buch Zeit verschwendet zu haben, kommt das Ärgernis, das auch noch aufschreiben zu müssen. Die Wertung “gut” oder “schlecht” interessiert zwar das Publikum, und deshalb darf man sie auch nicht vernachlässigen. Das gehört zum Service, den die Kritik zu liefern hat. Ebenso wie die Pflicht, knapp und präzise darüber zu informieren, worum es in dem betreffenden Werk geht, die sprachliche und formale Leistung zu würdigen, den historischen Hintergrund herauszuarbeiten, den Werkkontext zu kennen und literarische Querbezüge zu nennen.
Doch was mich beim Schreiben einer Kritik interessiert, ist etwas anderes: Ich will herausbekommen, was das für ein Mensch ist, der solche Bücher schreibt. Was muss er erlebt haben, um die Welt so zu beschreiben, wie er es tut? Ich versuche also, das Buch durchsichtig zu machen und zu erkunden, was sich darin an geschichtlichem Material, an Lebenserfahrung ausdrückt. Man kann fremde Erfahrungen nicht benoten. Man kann sie nur in ihrer historischen Bedingtheit zur Kenntnis nehmen und den Möglichkeitsraum abstecken, der vielleicht auch andere Handlungs- und Schreibweisen erlaubt hätte. Hinter dem Text versteckt sich der Autor. Oder vielmehr: Er versteckt sich nicht, sondern er zeigt sich. Und weil der Literaturkritiker in der Regel auch Journalist ist, kommt er vom Text zwangsläufig auf den Autor und von der Buchkritik zum Porträt. Meistens trifft man sich in einem Café, und hinterher kann man dann in der Zeitung lesen, wie es dort aussah, wie das Wetter war und wie der Autor in seinem Latte macchiato gerührt hat. Vielleicht erfährt man noch, dass er einen Hund hat und wie der Hund heißt, und Autor und Hund sind dann auch auf dem Foto zu sehen, das zu diesem Zweck eigens angefertigt wird. Dass das Porträt als journalistische Form ziemlich auf den Hund gekommen ist, spricht noch nicht grundsätzlich dagegen. Allerdings halte ich es für ein Missverständnis zu glauben, man könnte, indem man nach Barcelona oder New York fliegt, um dort eine Stunde mit dem jeweils gerade aktuell extrem angesagten Autor der Woche zu verplaudern, etwas erfahren, was man aus dessen Büchern nicht viel gründlicher erfahren könnte: nämlich wie er denkt und wie er fühlt. Der Cafébesuch kann nicht viel mehr sein als die Simulation eines Kennenlernens, das, wenn man Glück hat, den Blick auf die Selbstinszenierungen und auf die Verkaufsstrategien schärft. Doch davon ist in den Latte-macchiato-Porträts nur selten die Rede. Aus dem Literaturkritiker müsste dann ein Literaturbetriebskritiker werden, der mit den Bedingungen des Schreibens und der Vermarktung der Literatur auch die eigenen Abhängigkeiten in den Blick bekommt. Um Kritiken zu schreiben, muss man aber, und das ist das
5. und letzte Privileg: Alles vergessen
Da ich ein vergesslicher Mensch bin, der sich oft nur mit Mühe daran erinnern kann, was letzte Woche wichtig gewesen ist, ist dieses Privileg für mich besonders bedeutsam. Ich darf nicht nur vergessen, ich muss vergessen. Nur wenn es mir gelingt, alles außer dem Text selbst auszublenden, bin ich in der Lage, mit dem Schreiben zu beginnen. Ich könnte diese Vergessens-Anstrengung auch Konzentration nennen: Ich muss den Autor vergessen und was eine Kritik für ihn womöglich bedeutet – auch dann, wenn wir uns ein paar Wochen zuvor beim Abendessen ganz prima verstanden haben. Ich muss die Übersetzer vergessen, die so sehr darunter leiden, viel zu selten genannt oder gar gewürdigt zu werden. Ich muss den Verleger vergessen, der mir doch gerade dieses Buch als Ereignis ans Herz gelegt hat. Ich muss die freundliche Pressechefin vergessen, die mir das Buch geschickt hat, nicht ohne darauf hinzuweisen, der Autor hätte es verdient, endlich den Durchbruch zu schaffen und größere Aufmerksamkeit zu erhalten. Ich muss auch die Kritikerkollegen vergessen und die taktischen Überlegungen, mit welcher Haltung ich mich profilieren könnte. Und ich muss die Werbeabteilungen der Verlage vergessen, die auf zitierbare Sätze für ihre Anzeigen lauern, Sätze wie “Ein großes Werk” oder “Ein wunderbarer Roman”. Solche begehrten Floskeln versuche ich zu vermeiden, aber dann ertappen mich die PR-Abteilungen doch immer wieder dabei, Zitierbares produziert zu haben.
Man muss das alles vergessen, sage ich, und weiß dabei doch, dass es unmöglich ist, sich aus allem auszuklinken, um die Illusion einer Unabhängigkeit herzustellen. Man muss trotzdem so tun,als ob diese Freiheit möglich wäre. Kritik entsteht unter der Bedingung eines unausgesprochenen “Als-ob”: Als ob es möglich sei, sich für einen Text und nichts als den Text zu interessieren. Als ob es einen unschuldigen Raum ästhetischer Unberührtheit geben könnte. Als ob es darauf ankäme, was der Kritiker zu bemängeln hat. Dieser Raum des “Als-ob” ist der Raum der Kunst, den auch die Kritik bevölkert. So tun, als ob. Ich glaube, das trifft auf sehr viele Lebensbereiche zu, nur spürt man es nicht überall so deutlich. Der Literaturkritiker weiß, dass er nur so tut als ob. Ich möchte auch das zu den Privilegien rechnen.
Published 4 June 2007
Original in German
First published by Wespennest 147 (2007)
Contributed by Wespennest © Jörg Magenau/Wespennest Eurozine
PDF/PRINTNewsletter
Subscribe to know what’s worth thinking about.