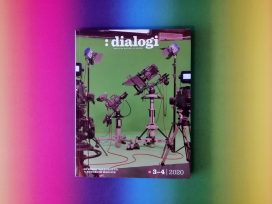
Clenched fists don’t make political theatre
Dialogi 3–4/2020
The Slovene journal talks to a theatre director taking political theatre beyond anticapitalist clichés; thoughts on the walkout as effective critique; and a debate on ‘punditocracy’.
Vor drei Jahren sah ich in Stuttgart eine Inszenierung der Carmen von Bizet durch Sebastian Nübling und schrieb darüber eine Rezension in Theater heute. Nachdem ich in dieser Publikation schon häufiger über die seltsame Beschränkung inszenatorischer Ideen durch eine dogmatische Handhabung der Unantastbarkeit des musikalischen Textes von Opern geschrieben hatte, entschloss sich die Redaktion, diese Konfrontationslinie zu einem Titelthema zu erklären, dessen Schlagzeile lautete: “Wie viel Regie verträgt die Oper?”
Mit der medizinischen Metapher der Verträglichkeit war ganz gut die vorherrschende Vorstellung getroffen, es gäbe eine uninszenierte Natur oder Physis der Oper, die man mit menschlichen Eingriffen krank machen könne.
Im Bezug auf das Thema “Interkreativität” fragte ich mich, ob nicht die Forderung nach der Begegnung von Künsten und Praktiken ebenso zu den Konvertierten predigt wie die berühmte und langsam berüchtigte Interdisziplinarität der Wissenschaften. Überall und nicht erst seit gestern vermischen sich Künste wie auch wissenschaftliche Disziplinen. Zugleich ist aber die Anordnung oder Verhängung solcher nicht so sehr notwendiger wie auf der Hand liegender, quasi naturwüchsig sich sozial und medial ergebenden Vermischung zur zentralen Komponente eines neoliberalen Flexibilismus in den Künsten geworden, der solche Begegnungen und Überschreitungen zum Selbstzweck macht.
So kommen gerade die guten Gründe zu kurz, warum solche vermischenden Praktiken einerseits stattfinden müssen – aus der Logik der Entwicklung künstlerischer und wissenschaftlicher Materialstände heraus nämlich –, andererseits sehr oft aber auch gerade nicht stattfinden sollten, wenn man bestimmte Eigengesetzlichkeiten ästhetischer und kulturell-sozialer Praktiken achtet. Vielleicht sind also gerade diejenigen Fälle am interessantesten, wo eine solche Vermischung der Praktiken, aber auch der intellektuellen Perspektiven rund um diese Praktiken mit aller Kraft verhindert wird, wie im Falle der Unberührbarkeit der geschriebenen Komposition im Musiktheater. Diese darf nur interpretiert, nicht modifiziert, verändert, verschoben und inszenatorischen Ideen unterworfen werden. Die Gesamtleitung hat der Dirigent bzw. die Dirigentin, nicht der Regisseur bzw. die Regisseurin.
Nübling hatte die Idee, die heterosexuelle Hölle in Carmen als blind gewalttätigen Wiederholungszwang bei einer gleichzeitigen Vervielfältigung der beteiligten Personen auszulegen: Die Personen waren nicht totzukriegen, solange die Gewalt gegen sie nur Symptom von etwas anderem ist, so könnte man’s vielleicht zusammenfassen. Über diese Deutung mag man denken, was man will, sie war aber inszenatorisch einigermaßen gelungen.
Die sattsam bekannte Carmen-Musik bot sich ideal an, gerade mit den Mitteln zeitgenössischer digitaler Musikbearbeitung in ähnlicher Weise bearbeitet zu werden: Loops, so könnte man sich das vorstellen, gezielt ungerade Loops, die sich überlagern und phasenverschoben mit der musikalischen Struktur auf eine fast schon zu genau passende Weise die psychologische Idee von Nübling aufgreifen würden. Die mitunter krawallige, überaus konturierte Carmen-Komposition hätte dafür ideales Material abgegeben. Womöglich hätte die “Umsetzung” – wie man heute sagt – der Idee mir gar nicht gefallen, eben weil sie nun doch fast zu naheliegend ist, aber mir wurde an der im Opernhaus natürlich körperlich spürbaren Ausgeschlossenheit selbst naheliegender Eingriffe in das heilige Material klar, dass es neben den geschenkt eingerissenen Grenzen und denen, die man am besten nicht einreißt, auch solche gibt, deren Unangetastetsein wohl tatsächlich ein massives kulturelles Symptom markiert.
Ich will im Folgenden aber nicht allein bei diesem Symptom bleiben. Ich möchte eher versuchen, Entwicklungen in Theater und Oper als ihrerseits bereits klassischen Vermischungskünsten, aber andererseits auch besonders gehüteten und ökonomisch besonders massiv ausgestatten Künsten, in Verbindung bringen mit gesellschaftlichen Debatten, die in letzter Zeit geführt wurden und Licht werfen auf ein Verhältnis von Überschreitungs-und Vermischungsphänomenen an Orten, wo sie nicht wie in der digitalen Kultur und den Subkulturen zum Alltag gehören, und dem je kulturell und kulturpolitisch von diesen Phänomenen Gemeinten.
Ausgangspunkt meiner Überlegungen sind drei Beobachtungen:
erstens ein Boom des Begriffs Oper in bildender Kunst aber auch unter LiteratInnen, PopmusikerInnen. Alle wollen Opern schreiben, realisieren, alle wollen Dinge, die man auch anders nennen könnte, Oper nennen. Von Hans Ulrich Obrists und Philip Parrenos Il Tempo del Postino in Basel, Edinburgh und anderswo mit unter anderem Beiträgen von Doug Aitken, Matthew Barney, Tacita Dean, Olafur Eliasson, Carsten Höller, Fischli/Weiss, Tino Sehgal, Dominique Gonzalez-Foerster, Anri Sala, Rirkit Tiravanija und anderen HeldInnen der relationalen Ästhetik bis zu der in Venedig aufgeführten Oper No Night, No Day von Cerith Wyn Evans und Florian Hecker arbeiten bildende KünstlerInnen mit dem Begriff, SprechtheaterregisseurInnen von Frank Castorf über Sebastian Baumgarten bis David Merton versuchen sich zunehmend an Bearbeitungen von Opern, die sie auch musikalisch leiten; jüngere AutorInnen wie Albert Ostermaier oder Marcel Beyer schreiben in großer Zahl Opern.
Die zweite Beobachtung betrifft den immer wieder aufflackernden, nun auch schon gut 20, 30 Jahre alten Kulturkampf um das sogenannte Regietheater. Eigentümlich an dieser Diskussion, die in jedem Jahr an einem anderen Anlass losbricht, ist, dass zwar seit Jahren kaum neue Argumente auftauchen, aber die Heftigkeit der bekannten immer wieder aufs Neue aufgebracht werden kann. Vor gut einem Jahr wärmte Daniel Kehlmann die Debatte auf, vor ganz kurzer Zeit die unappetitlichen bis reaktionären Suggestivtexte von SZ– und FAZ-AutorInnen, die in Helene Hegemanns Buch Axolotl Roadkill, in dessen Erfolg und vor allem in der vermeintlich bedeutenden Rolle, die plagiierte Teile darin spielen sollen, einen moralisch-kulturellen Abgrund von Kindesmissbrauch und Parasitentum erkannt haben wollen, für den wiederum das Regietheater ursächlich verantwortlich sein soll, denn der Vater der Autorin, der Volksbühne-Dramaturg Carl Hegemann, sei doch wahrscheinlich für die Verwahrlosung seiner Tochter in Dingen des geistigen Eigentums (und nicht nur darin) verantwortlich. Davor war es die possierliche, sogenannte Spiralblockaffäre, als ein wütender, vom Regietheater verrohter Schauspieler einen der schärfsten Kritiker des Regietheaters tätlich angriff und ihm kastrativ um seinen Notizblock brachte.
Die dritte Beobachtung schließlich bezieht sich auf ein anderes kulturkämpferisches Geräusch, das weniger von kurzen heftigen Ausschlägen gekennzeichnet ist, wie die Regietheaterdebatte, sondern von einem langen gleichmäßigen Anschwellen. Dies sind die Debatten um Bürgerlichkeit und neue Bürgerlichkeit. Sie wird im deutschsprachigen Raum – anders als die Regietheaterdiskussion – in unterschiedlicher Verteilung geführt, stärker in Deutschlands Norden und in Baden-Württemberg als im katholischen Süden oder in Österreich: In München und Wien muss sich das Bürgertum weniger definieren, in Hamburg schon eher, besonders aber in Berlin. In ihr geht es zunächst um Weltanschauungs- und Orientierungsfragen, klassische “Wie wollen wir leben?”-Rhetorik, kenntlich durch wiederholte Bezugnahmen auf wiederkehrende Motive:
1.) Bildungspolitik, Schule, Kindererziehung
2.) Migration, Integration, Leitkultur
3.) Erinnerungskultur.
Intellektueller wie rhetorischer Motor der Debatte ist jedoch, dass sie gezielt nicht nur nicht unterscheidet zwischen dem Bürger als Citoyen und dem Bürger als Bourgeois. Vielmehr vermischt sie diese Bedeutungen absichtsvoll und überblendet so ständig die Frage “Wie wollen wir alle leben?” mit der Frage “Welche herrschende Klasse hätten wir gerne und wer darf zu ihr gehören?”
Opernmode und Regietheaterdebatte sind zwar keine besonders exponierten, aber doch kenntliche Unterdebatten der Bürgerlichkeitsdebatte. So wie sich die Bürgerlichkeitsdebatte mit Fragen der Grenzziehung beschäftigt und programmatisch Fragen durchdekliniert wie: Wer sind eigentlich wir, und wer wollen wir nicht sein, mithin: wer gehört nicht zu uns?, so liefern die beiden nicht unbedingt in die gleiche Richtung zeigenden Phänomene Opernsehnsucht und Regietheaterverachtung Beiträge zu allen Punkten, um die es bei der Bürgerlichkeitsdebatte geht: Wie gehen wir mit unserer Vergangenheit um? Beziehen wir sie auf unsere Gegenwart oder bauen wir ihr ein Museum? Dürfen und sollen alle Stoffe in unser kulturelles Zentralorgan, das Theater, Einlass finden? Ist das Theater überhaupt unser Zentralorgan?
Dabei hat es eine gewisse Tradition, das Verhältnis der Künste zueinander mit dem Verhältnis der Künste zur Wirklichkeit oder zum größeren Ganzen parallel zu schalten. Alle ästhetischen Bewegungen, die von den Künsten einen engeren Weltbezug verlangten, verlangten fast immer auch die Überschreitung disziplinärer Grenzen, also ein anderes Verhältnis der Künste zueinander. In der Disziplin verbarg sich für solche Anrufungen immer der spezifische mimetische Mangel einer Kunst: Weil die Malerei nicht redete, die Musik sich den konkreten Bildern entzog, die Architektur mit Symbolen geizte, waren sie nicht so nahe an der Wirklichkeit, wie sie sein könnten.
Insofern haben Leute, die Kunst für revolutionäre Zwecke einsetzen wollen, eines gemeinsam mit Leuten, die Kunst für ökonomische oder didaktische Zwecke nutzen möchten: Sie finden die Schranken zwischen den Disziplinen ebenso hinderlich für eine bessere Instrumentalisierung der Künste wie die je kunst-und medienspezifische Distanz der jeweiligen Künste zu Welt oder Wirklichkeit.
Vielleicht klingt der Begriff der Instrumentalisierung manchen zu harsch für das, was Verwertungen, aber auch politische Praxis mit Kunst vorhatten, vor allem, weil die Alternative auch nicht so gut dasteht:
Hier gibt es ebenso feudale wie aufgeklärte FürsprecherInnen einer Selbstbeschäftigung der Disziplinen mit ihren Regeln, Formaten und Medien. Zum einen die hochmodernistischen AutonomievertreterInnen von Clement Greenberg bis Theodor W. Adorno, zum anderen die klassisch Kunstreligiösen von Rudolf Borchardt bis Stefan George, die von den DiskutantInnen des Bürgerlichen ja auch gerade massiv wiederentdeckt werden und den konservativen kulturpolitischen Hit des letzten Sommers orchestrieren helfen: das geheime Deutschland.
Jedenfalls haben beide VertreterInnen eines Eigenrechts des Künstlerischen – linke AutonomistInnen und rechte HermetikerInnen – je einen Bruder im Geiste unter den VermischerInnen und ÜbertreterInnen: Die Kunstreligiösen fühlen sich vom Gesamtkunstwerk als totaler bis totalitärer Versöhnung der Künste in unterschiedlicher Intensität angezogen, die HochmodernistInnen haben selbstverständlich eine Beziehung zur Avantgarde und ihren Übertretungsideen.
Dass man aber überhaupt von “den” Künsten redet als einer Reihe von distinkten und relativ autonomen Praktiken und Traditionen, ist natürlich heutzutage längst altmodisch geworden, ohne dass die genannten und andere ältere Konflikte gelöst wären. Je nach politischer Überzeugung und Milieu spricht man stattdessen von kultureller Praxis oder von Kreativindustrien. Selten legitimiert sich noch künstlerisches Handeln über einen spezifischen Bezug auf ein Medium, ein Handwerk, ein vorgegebenes Regelwerk. In die neuen Begriffe – kulturelle Praxis und Kreativindustrien – sind dagegen schon Resultate von Vermischungen und Überschneidungen eingegangen, die während der Moderne erzielt worden sind. Es fragt sich aber nicht nur, ob wir mit diesen Resultaten leben wollen, sondern auch in welcher Weise wir es die ganze Zeit schon tun.
Denn, so meine These, die gegenwärtigen bzw. wiederkehrenden Bezugnahmen auf Regietheater und ein bestimmtes Interesse an der Oper sind Versuche, die Handlungsfähigkeit der Künste als Künste wiederherzustellen und die Illusionen zu rekonstruieren, kraft derer man einst glauben konnte, dass die Organisation der beiden bürgerlichen Groß- und Zentralkünste Theater und Oper, die zugleich erstens Vermischungskünste und zweitens immer in einem symbolischen Verhältnis zum je historischen Selbstverständnis eines Bürgertums gestanden haben, das sich noch als herrschende wie als leitkulturelle Klasse verstehen konnte, die Gesellschaft selbst organisieren. Und obwohl ich dies eine Illusion nenne, glaube ich, dass man zu einer brauchbareren Position nur kommen kann, wenn man sich mit den in jetzigen Sehnsüchten, Begehren und Geisterdebatten aufflackernden unerledigten und abgegoltenen Problemen beschäftigt.
Die Bürgertumsdiskussion würde demnach Theater und Oper zurückhaben oder am Leben erhalten wollen, weil sie der seit der technischen Aufrüstung der Kulturindustrien zu Beginn des 20. Jahrhunderts unabwendbar gewordenen Vermischung der Künste etwas entgegensetzen können; sie sind sozusagen zwei Vermischungskünste, die sich nicht nur nicht ständig mit Welt vermischen und darüber hinaus in deren ökonomischer Logik aufgehen wie die kulturindustriellen Praktiken der Kreativindustrien, sondern auch nicht direkt in der Pragmatik der Interventionen aufgehen wie manch kritische Praxis der KulturproduzentInnen. In ihnen ist die sowohl aus der Eigenlogik der Künste wie aus scheinbar unbeherrschbaren Dynamiken der Medientechnologie und der Kulturindustrie entstandene Tendenz zur Vermischung auf einem bestimmten Stand eingehegt.
Theater und Oper als Bezugspunkte von ästhetischen Mischverhältnissen sowohl unter den Künsten wie von Kunst und Welt bleiben so ein nostalgisches Motiv eines weitgehend entmachteten alteuropäischen Bürgertums, das dieser Machtlosigkeit ebenso wie einer an dessen Stelle getretenen, unanschaulich gewordenen, kulturell indifferenten oder unübersichtlichen Herrschaftsstruktur etwas entgegensetzen soll. Dabei sind aber diese beiden internen Phänomene – Regietheaterdebatte und Opernsehnsucht – unterschiedliche Symptome dieser Nostalgie.
Auch diese Nostalgie sollte man nicht nur als reaktionär vom Tisch wischen, selbst wenn sie es zu einem guten Teil ist. Zu einem anderen Teil ist nämlich die Mobilisierung der Differenz des Kunstwerks zur Welt, sein Nichtaufgehen weder in Intervention noch in Werbung und Dekoration auch ein Ausgangspunkt utopischer Energien und Leidenschaften des Nichtidentischen. Wir kommen hier nur weiter, wenn wir uns die Formen und Formate aktueller Vermischungskünste anschauen und zwar gerade im Hinblick auf ihr historisches Moment. Sie sind alle entstanden und haben eine Form gefunden, die bereits ein Problem aus dem Kreis der oben umrissenen Selbstverständigungen des westlichen Bürgertums lösen oder beantworten soll. Sie sind alle Gegenvorschläge oder Erfolge zu einem je historischen Materialstand.
Theater und Oper sind Vermischungskünste, die – ihrem allerdings weitgehend fantastisch gewordenen Selbstverständnis nach – noch nicht ein industrieller, technischer und arbeitsorganisatorischer Zwang zu dem macht, was sie sind, sondern die sich noch ganz aus den je künstlerischen Legitimationsdiskursen ableiten, die sie jeweils begründeten: Reinhardt, Kortner oder Zadek sind keine medialen Standards. Das Regietheater ist das Ergebnis einer kritischen Reflexion auf diesen Denkfehler, der entweder nur technisch-mediale Determination kennt oder aber freie Künste. Das sogenannte Regietheater markiert den Moment, der in der bildenden Kunst von der Institutional Critique markiert wurde und der eine Kunst der Kritik an Kunst formulierte und produzierte, die nicht die Formate von den vorausgesetzten technischen Medien oder den handelnden Genies ableitete, sondern die handelnden Genies und die Funktion der Medien von der politisch zu verstehenden Geschichte der Institutionen, hier das bürgerliche Theater.
Die aggressive Kritik am Regietheater der letzten Zeit hält diesem nicht vor, dass es sich auf einem Stand der Dinge bequem eingerichtet hat, der bereits um 1970, spätestens 1980 erreicht worden war und nun nur noch Symptome reproduziert, statt die Kritik der Kunst als Kunst am Objekt Institution voranzutreiben, nein, sie hält ihr vor – und das ist eine neuere Entwicklung innerhalb dieser weitgehend alten Debatte –, dass sie mit traditionellen Texten nicht diesen Texten gemäß umgeht (der fragliche Begriff, der immer wieder auftaucht, lautet tatsächlich “werktreu”). Mit anderen Worten, dass sie nicht einem Projekt der Musealisierung von Theater zuarbeitet, das in vielen Aspekten der Opernkultur schließlich durchaus unbeanstandet existieren kann.
Tatsächlich scheint es, dass, als die bürgerliche Bühnenkunst in das Stadium der institutionellen Kritik getreten ist, die Beute in einer Art Kompromiss geteilt worden ist: Die kritische Fraktion bekam das Sprechtheater, die museale das Musiktheater. Dass es so etwas wie ein institutionskritisches Musiktheater etwa bei Mauricio Kagel oder Pierre Henry auch einmal gegeben hat, ist erfolgreich in den Off-und Festivalbetrieb und aus den großen potent ausgestatteten Häusern und Festspielen verdrängt, also von der klassischen institutionellen Basis des Staatstheaters und der Stadttheater entfernt worden. Bei beiden Bühnenkunstformen dreht sich die Debatte aber um die Frage, wie stark das allographische Skript, ob es nun aus Noten oder Worten besteht, verändert werden darf. Die “interkreative” Pointe an Regietheater wie an Opern-Crossover ist also nicht so sehr, dass eine weitere Kunst oder ein weiteres mediales Format integriert werden soll, sondern dass der Realitäts- oder Weltbezug anders tariert werden soll. Der autografische Anteil soll gegen den allographischen Anteil gestärkt werden.
Auf dieser Ebene begegnen wir wieder einer Gemeinsamkeit, wenn auch historisch leicht verschoben, zwischen politisch-kritischer und instrumentell-industrieller Bezugnahme auf die Künste. So hat die politische Kunst, insbesondere die kritische und politische Bühnenkunst, den autografischen Anteil an ihrer Kunst hochgetrieben; autografische, nicht gescriptete Formate sind allerdings auch die große Zuwachsbranche der Kulturindustrie.
So kommt es, dass nicht nur die Gattung der Performancekunst als hauptsächlich autografisches Konkurrenzunternehmen zur klassischen Bühnenkunst diese bei ihrem mangelnden Wirklichkeitsbezug angreift oder umbaut, sondern dass auch die billigen Erfolgsformate des kritischer Positionen unverdächtigen, sogenannten Unterschichtenfernsehens (Reality-TV, Reality-Soaps, Talkshows, Kandidaten-Soaps) das Script durch die Selbstdarstellung ersetzen. Kritische wie spekulative TheaterreformatorInnen bringen SelbstdarstellerInnen auf die Bühne oder erhöhen den selbstdarstellerischen Anteil. Das Script kann nicht nur umgedeutet und umgeschrieben werden, es kann auch durch etwas ersetzt werden, das gar kein Script mehr ist – und das sich so den performativen Kategorien anderer Künste und Unterhaltungsformen annähert.
Dieser autografische Pol, an dem sich in unterschiedlicher Gestalt kritische und exploitative Formen begegnen, steht dem bürgerlich-rekonstruktiven gegenüber, der gerade dadurch eine gewisse Attraktivität gewinnt: über seine anachronistische Singularität. In dem Versuch der Bürgerlichkeitsdebatte, Bürgerlichkeit als heroische Gegenposition zu rekonstruieren, die ganz außerhalb der Zeitläufe steht, jenseits von links-kritisch einerseits und vulgär-kommerziell andererseits, spielt darum museales Theaterverständnis eine große Rolle. Diese Attraktivität ist natürlich auch einer der Gründe für das Interesse der bildenden Kunst an der Oper, auch wenn man dieses Interesse noch näher beschreiben muss.
Künstlerische Entwicklungen ergeben sich nicht, weil jemand “seiner Zeit voraus” ist, noch weil jemand etwas “erfunden” hat: technisch, künstlerisch, medial. Sie ergeben sich, weil etwas sichtbar ist. Nicht immer wird realisiert, was aus dieser Sichtbarkeit folgt. Natürlich gibt es Widerstände, weder sollen diese unterschätzt, noch der Heroismus überschätzt werden, sich gegen diese durchzusetzen. Sichtbarkeit heißt: Perspektiven auf künstlerische Praxis werden frei, die deren Transformation ermöglichen. Man kann die Praxis in ihrem Entstandensein, ihrer Bedingtheit, von einem Außenstandpunkt erkennen und als Material behandeln, nicht nur wie sonst das Material, das durch die bereits eingespielte Praxis sichtbar wurde: der sogenannte Inhalt.
Institutionskritik ist so ein Moment gewesen. Charakteristisch für solche Momente bzw. Durchbruchssituationen sind metakünstlerische Fragestellungen. Metakünstlerisches Denken ermöglicht nicht nur, den Gegenstand der eigenen oder einer entfernteren künstlerischen Praxis zu reflektieren, sondern die sogenannten Künste in ihrer sogenannten Gesamtheit. Dabei ist allerdings der entscheidende Punkt, dass diese als die sich summierenden Künste nicht mehr auftreten, dass also der metakünstlerische Blick je und je etwas anderes hervorbringt. Er ist kein neutraler Aussichtspunkt, den eifrige Wanderer in selbstloser Selbstzucht erreichen können, sondern sein Zustandekommen und auch das, was ihm in den Blick gerät, sind historischen Entwicklungen unterworfen, auf die frühere, auch immanente Bestrebungen ihre spezifischen und konkreten Schatten werfen.
Man kann also nicht, was nach den bisherigen Überlegungen nahegelegen hätte, Theater und bildender Kunst raten, ihre Projekte einer metakünstlerischen, institutionskritischen Praxis einfach dort wieder aufzunehmen, wo sie historisch liegen geblieben sind. Die zentrale Veränderung ist die, dass die kritischen Vermischungsformen und die kritischen Weltbezugserzwingungstechniken sich in einem Boot mit neoliberaler Liveness-Exploitation finden. Dies ist ein Prozess, der durchaus mit dem Erfolg dieser Praktiken im weitesten Sinne zu tun hat, die aber nicht wegen ihres Erfolges in dieser Lage gelandet sind, wie ein Distinktionsdenken mit seinem Diskurs der Angst vor sogenannter Vereinnahmung immer wieder beschwört, sondern weil sie veränderte gesellschaftliche Bedingungen, den Übergang einer ablenkenden Spektakel- und Ruhigstellungskulturindustrie zu einer Mobilisierungs- und Partizipationskulturindustrie nämlich, nicht berücksichtigt hat. Der andere Teil dieser Veränderung ist die Nähe, die alte strengere avantgardistische Praktiken – etwa in der neuen Musik – auf diese Weise plötzlich zu elitären HermetikerInnen empfinden. Die falsche Antwort wäre etwa eine wie die, die Alain Badiou gibt, der seine ästhetische Theorie auf dem althochmodernistischen Kanon aufbaut – Beckett und Schönberg.
Die richtige Antwort müsste sich fragen, was institutionskritische metakünstlerische Blicke denn heute erkennen, wenn sie sich die Unterschiede unter den Praktiken, also das, was man früher die Künste nannte, ansehen. Der etablierte metakünstlerische Blick der bildenden Kunst erkennt offensichtlich etwas Begehrenswertes in der Oper, wenn man einmal unterstellt, dass es nicht nur Glanz, Apparateneid und andere großmannssüchtige Projektionen sind. Dies könnte der besondere Protokollcharakter der Oper sein, ihr hohes Maß an Bestimmtheit, das auch ihre konservativen und orthodoxen VertreterInnen zu schätzen scheinen, wenn sie die Unantastbarkeit der Partitur mit Klauen und Zähnen verteidigen.
Es gibt einen guten und aktuellen historischen Grund, der tatsächlich mit dem Fragwürdigwerden bestimmter Partizipations- und Mobilisierungsreflexe zu tun hat, mit dem Ausleiern klassisch kritischen künstlerischen Vokabulars, die Eigenschaften der Bestimmtheit zu schätzen. Nur wäre es total fetischistisch und undialektisch, sie auch genau da zu suchen, wo sie qua Konvention unangetastet sind, nämlich in der Partitur. Es ginge darum, heute sichtbares und verfügbares Material – das aktuelle, subkulturell entwickelte, verfeinerte soziale Wissen, die Erhabenheit der immensen Zugänglichkeit von Archiven und Datenmengen, die nichteuropäisch-weiß-heteromännliche historische Perspektivenvielfalt – in einer Weise zu behandeln, die die Definiertheiten der Oper nutzt und ausbaut.
In einer ähnlichen Weise dialektisch wäre mit der Opposition von Allographie und Autografie umzugehen. Dass künstlerische Entwicklung in vielen Genres von Theater, Performance und Musik bedeutet hat, die autografischen Anteile zu stärken und – historisch nicht unberechtigt, aber doch etwas schlicht – davon auszugehen, dass auf diese Weise ungute Repräsentationsverhältnisse sich qua Abkürzung verbessern, habe ich schon angedeutet. Auch hier kann man an zahlreichen Beispielen – René Pollesch wäre eines der allerbekanntesten – zeigen, wie eine Umverteilung eher als eine Ausweitung erfolgreich wäre.
Die SchauspielerInnen performen ein Script, also allographisch, aber sie tun dies nicht in einer Akteur-Rolle-Beziehung, sondern nach anderen, zunächst einmal künstlichen Regeln. Dadurch wird aber eine ganz andere Energie für eine tatsächlich selbst entwickelte autografische Darstellung ihres Arbeitens und ihrer Professionalität möglich. Indem Pollesch zum Beispiel nur die Darstellung eines Stückes durch ganz bestimmte DarstellerInnen als angemessen definiert wie zuvor Thomas Bernhard mit Minetti und Ritter, Dene Voss – Aufführungen desselben Stückes mit anderen DarstellerInnen heißen bei ihm “Raubkopie” –, führt er so etwas wie eine gecoachte Autografie ein, während er an anderen systematischen Stellen des Kunstwerks die Komplexität und dadurch auch die Erkennbarkeit des Scriptes hochtreibt und mit ihm den allographischen Aspekt. Damit nicht genug: Dieses Script baut stark auf Zitaten auf, die dann wiederum in direkt übernommenen Titeln wie “Stadt als Beute” und “Ich schau Dir in die Augen, gesellschaftlicher Verblendungszusammenhang” das Stück als Bearbeitung eines Textes aus einem anderen, sachtextlichen, theoretischen Genre ausweisen, also auch die Allographie noch einmal steigern.
Dies sind nur Beispiele, die etwas anderes zeigen sollen. Es gibt einen Materialstand künstlerischer Techniken in einem stark erweiterten Sinne, denen die Genres der Künste nicht mehr entsprechen. Statt sich aber diesem Umstand einfach zu unterwerfen, indem man die Pforten öffnet und flexibilistisch auf dem jeweils schwächsten Stand von Bestimmtheit Praktiken entwertet, indem man sie indifferent ineinanderfließen lässt, ist genauso falsch wie die orthodoxe Verteidigung des Historischen. Ob in der Bürgerlichkeitsdiskussion oder in den zu Bespaßung herunterkommenden Partizipationsformaten, sei es in Kunst, sei es im Privatfernsehen, lässt man quasi die alten Klassenverhältnisse wieder zuständig werden für die Entwicklung der Künste: Die BürgerInnen haben eine wohldefinierte konventionelle, die Bohemiens und die Unterschichten haben eine flexibel undefinierte. Der Grad an Definiertheit entspricht in etwa den ökonomischen Sicherheiten der Betreffenden. Der Begriff von Materialstand ermöglicht das Anschauen von künstlerischen Möglichkeiten gerade auch als soziale, kulturpolitische, interventionistische, jenseits der Geprägtheit durch konkrete Klassen und ihre Kulturen. Von dort aus muss sich das entwickeln, was “Interkreativität” genannt wird.
Published 26 August 2010
Original in German
First published by Springerin 2/2010
Contributed by Springerin © Diedrich Diederichsen / Springerin / Eurozine
PDF/PRINTSubscribe to know what’s worth thinking about.
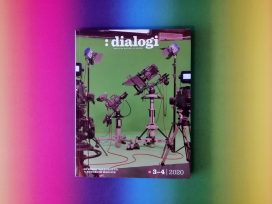
The Slovene journal talks to a theatre director taking political theatre beyond anticapitalist clichés; thoughts on the walkout as effective critique; and a debate on ‘punditocracy’.

Celebrated playwright and theatre director Matthias Lilienthal talks about the past, present and future of what he calls the ‘theatrical mode of production’, the new forms it might bring about, and the new audiences attending radical theatre productions.